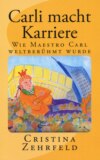Buch lesen: «Meine Epoche Ost»
Kalman Kirchner
MEINE EPOCHE OST
Eine autobiografische Erzählung
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2016
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Gestaltung: Maria Müller
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Prolog
Zurück zu den Wurzeln
„Maguela“ und beim Frisör
Ab jetzt zu mir
Der Staat – seine Organe und ich – Teil 1
Mohn – kann man davon einen Rausch bekommen?
Im Paradies
Die Sammler
Haus und Hof
Der Tierhalter – Teil 1
Warum rasiert man einen Knödel? Oder: mein anderer Opa
Der Tierhalter – Teil 2
Der Ministrant
Tabak
Fische fangen
Tuten, Kuba und Mosis
Sex mit sechs
Der Staat – seine Organe und ich – Teil 2
Die Schulzeit
Der Staat – seine Organe und ich – Teil 3
Die schönste Zeit im Jahr
Bauen, anbauen, umbauen
Kann man glühend heißes Eisen anfassen?
Session
Die Penne
Ferienarbeit
Kein Moped – kein Spaß?
Man nannte ihn Jack
Er tat, als ob er dösen wolle
„Schmirzeln“
Karneval
Der Leihwagen
Westbesuch
Wo verlaufen die Grenzen zwischen Blödheit und Schwachsinn?
Rock und Pop und Blues und Rock Jazz und, und, und
Ich muss zur Fahne
UFO
Politunterricht – und was wir sonst so trieben
AWACS
Gefechtsalaaaaarm!
Die Russen
Lange Tage bei der NVA
Fischlstechen
Geschafft!
Prag
Entlassungsfeier
Studieren
Discomucke
Wie erobert man seine Traumfrau
Der verwunschene Wolf
Ein Ausflug
DR – Deutsche Reichsbahn
Fleißig, fleißig
Sommer in Ungarn
Jesuslatschen – streng verboten!
Frob
Reservist der NVA! Noch mal der ganze Scheiß?
Männertag
Zwickau – Glauchau – Leningrad – Riga – Tallinn
Auf zum 7. Semester
RoBuR und andere Krankheiten
Akademischer Grad im VEB
Der „technische“ Hahn im Korb
Das Ende der Geduld
Abhauen!
Mein Tag „X“
Willkommen in der Freiheit
Wiener Schnitzel
Kaiserstraße
Aus die Maus
Perspektiven
Begriffserklärungen
VORWORT
Meine Aufzeichnungen sind all denen gewidmet, die mit diesem darin abgehandelten Zeitraum etwas anfangen können. Und denen, die sich daran erinnern möchten, denen, die neugierig auf solche Zeitgeschichten sind, Episoden aus einem Staat, den es nicht mehr gibt. Denen, die es sich nicht vorstellen können oder wollen, wie manches im „anderen“ Teil Deutschlands ablief. Verfasst auch für all diejenigen, die das mit mir auszuhalten hatten – allen Mitmenschen aus meinem direkten Umfeld: Danke!
Besonderer Dank geht an die hilfsbereiten Österreicher aus dem idyllischen Burgenland, die uns herzlich empfingen und sich fürsorglich um uns kümmerten, als wir deren Boden ungefragt betraten. Danke an alle Menschen in Ungarn und Franken, die mit involviert waren und es uns dadurch leichter möglich gemacht hatten, den unwiderruflichen Schritt in eine andere Richtung zu wagen. Expliziter Dank an die erlesene Weiblichkeit, die mir die ganz speziellen Momente bis dahin versüßte. Und danke, Petra K. aus M., denn du sagtest zu mir: „Das musst du doch aufschreiben!“
PROLOG
Das waren siebenundzwanzig Jahre in dem deutschen Teil, der gar nicht mehr zu Deutschland dazugehören sollte, wäre es nach dem Willen der seinerzeit Regierenden gegangen. Dass es denen letztendlich nicht mit der totalen Abspaltung gelang, bezeugt die jüngere Geschichte. Nicht selten spielt das Leben halt anders, als man es sich in seiner kühnsten Fantasie ausmalen kann.
Etwa ein viertel Jahrhundert geht in so einem Staatsgebilde nicht spurlos vorüber und hinterlässt eine spezielle Prägung seiner Bürger. Nicht unbedingt negativ, nein, nur etwas anders im Vergleich zu den „restlichen“ deutschsprachigen Strukturen. So war es auch bei mir. Schließlich konnte ich mir es nicht aussuchen, wo hinein ich geboren wurde, wie und wo ich aufwachsen werde!
Ich glaube, ein Kind kommt mit den unterschiedlichsten Milieus und Gesellschaftsformen viel eher zurecht als ein Erwachsener. Mal abgesehen von extremen Formen, so weit war es größtenteils nicht. Wenn man irgendwo hineingeboren wird und mit diesen Gegebenheiten aufwachsen muss, spielt es nicht die primäre Rolle, viel zu besitzen. Das Schönste für ein Kind ist es, glücklich sein zu dürfen, egal wo. Und Glück hängt nicht von finanziellem Reichtum ab.
Mein Dasein war nie von irgendeiner Art „Überlebenskampf“ oder empfundenen Mangelerscheinungen geprägt. Zudem gab es ja in der Zeit meiner Kindheit auch kein starkes soziales Gefälle: Ob Lehrer, Arbeiter, Zahnarzt, die Lohntüten oder Gehälter unterschieden sich zwar schon etwas voneinander, aber bei Weitem nicht so stark wie in den späteren Jahren.
So wuchs ich in einer für ostdeutsche Verhältnisse recht gut situierten Familie auf. Es war ein elterlicher Mix aus Intelligenz (unter dieser staatlicherseits geprägten Rubrik wurden die Pädagogen eingestuft: meine Mutter) und sogenannter Arbeiterklasse (der Vater, ein Werkzeugmacher). Später kam mein Schwesterchen dazu. Somit waren wir vollzählig.
Wir lebten zusammen mit meinen Großeltern mütterlicherseits in einem eigenen Haus in einer typischen Kleinstadt mit viereinhalbtausend Einwohnern in einem Teil im „Tal der Ahnungslosen“ – wie es sprichwörtlich bezeichnet wurde. Denn meine Landsleute dort dürften mit zu den „ahnungslosesten“ überhaupt gezählt haben, wenn man das auf den Empfang westlicher Medien bezieht. Doch dazu später mehr.
Ich hatte für mein Befinden wirklich eine unbeschwerte und glückliche Kindheit. Es waren eher die Ärgernisse, die stetig größer werdenden Engpässe, die indirekte oder direkte Bevormundung und wachsende Beschränkungen, die mit zunehmendem Alter zunächst nur nervten, dann störten, später mehr zum „anarchischen Verhalten“ meinerseits und auch weiterer Teile der „ahnungslosen“ Bevölkerung führten.
Die Mehrzahl der Bürger ahnte es und war davon überzeugt, dass das Experiment einer sozialistischen Gesellschaft früher oder später scheitern würde, falls es weiter so bergab ginge. Nur vorstellen konnte man es sich nicht wirklich.
Klar, es gab und gibt immer Mitmenschen, die jede Gesellschaftsform so egoistisch wie möglich für sich ausnutzen können und dabei in Kauf nehmen, dass andere benachteiligt oder geschädigt werden. Dieses Verhalten war sicher besonders prägend im Handeln der Führungsriege in Ostberlin, die mit ihren Untergebenen, „ihrem“ Volk, lange genug herumexperimentierten. Despoten vergangener Jahrhunderte hätten das nicht besser hinbekommen.
Was konnte man denn tun? Den Kopf in den Sand stecken, alles schlucken, egal was kommt, schön brav mitlaufen oder gleich resignieren? Oder so aufmüpfig sein, um mit Knast belohnt zu werden? Beides waren keine Intentionen für mich und eine Zwischenlösung konnte ich mir auf längere Frist nicht vorstellen. Für mich gab es irgendwann einfach keine Perspektiven mehr innerhalb der Grenzen dieses „Experiments“. Es war nicht „das Meine“ und alles hat eben sein Limit. Und 1989 war es dann so weit.
Was bis zu diesem, für mich historischen Wendepunkt alles Witziges, Lustiges, Nachdenkliches und Seltsames geschah und publizierbar ist, wird hier aufgeschrieben. Klar gab es auch Trauriges. Einer der bewegendsten Momente war, als 1980 meine liebe Oma starb.
Ich habe einen Teil an Tatsachen aufgeführt, „meine“ Wahrheiten und Erlebnisse, die ich der geneigten Leserschaft zumuten will. Nein, es sind keine Märchen. Es sind Episoden, meine Erinnerungen. Auch keine Autobiografie, ich bin ja kein Prominenter. Viele haben sicher Ähnliches erlebt, es nur nicht zu Papier gebracht. Obwohl: Ein paar Unikate dürften schon dabei sein. Freunde, die manche der Storys kennen, nervten mich oft: „Das musst du aufschreiben!“
Na gut, also fing ich damit an, mir irgendwann Notizen zu machen und nach mehr als achtzehn Jahren „geistiger Sammlung“ liegt das gereifte Resultat nun vor: Meine „Epoche Ost“. Geschichten, wie sie sich in meinem Alltag abspielten, ungeschönt, einfach drauf zugeschrieben. Selbst die meisten Namen sind real. Nur einige davon habe ich bewusst geändert, es ist ja nicht meine Absicht, jemanden zu verärgern. Bis auf wenige gewollte Ausnahmen sollte sich auch niemand beleidigt fühlen, oder?
Und wenn schon! Was soll’s. Auch nicht schlimm …
Es war also wirklich einmal und – vor noch gar nicht so ewig langer Zeit.
ZURÜCK ZU DEN WURZELN
Die Quelle meiner Vorfahren (sozusagen die genetischen Wurzeln meines Ursprungs) lag außerhalb der Grenzen Nachkriegsdeutschlands. Germanen gab es fast überall auf der Welt, ohne tiefgründiger in das „Warum“ einzutauchen. Sie tummelten sich mal mehr, mal weniger friedlich seit Jahrhunderten in den verschiedensten Regionen. Abgesehen von den Potentaten, die in kriegerischer Absicht auftraten, wie während der Zeit, als ein geisteskranker (An-)Führer oberösterreichischer Herkunft die Deutschen in der ganzen Welt über tausend Jahre dauernd ansiedeln wollte.
Die, auf die ich mich hier beziehe, waren ein friedliches Völkchen. Jede der unter diesem Volksstamm lebenden Grüppchen entwickelte ihre individuellen Besonderheiten, Eigenarten und Dialekte.
Eine dieser, eine ganz besondere Fraktion, war mit Sicherheit die, die sich vor zig Jahrzehnten oder Jahrhunderten – wer weiß das schon genau – in den (nach 1945 wieder neugegründeten) ungarischen Landen niederließen. Davon galten als besonders speziell diejenigen, die in dem nördlich vom Balaton liegenden Gebiet um Veszprém und Zirc (sprich: „Wesbrehm“ und „Sierz“) herum siedelten. Hier ist auch der Ursprung meiner Vorfahren zu finden.
Ein überwiegender Teil derer stammte aus Rossbrunn (auf Ungarisch: Lókút), einem Dorf mit „Weltgeltung“. Muss wohl so gewesen sein, heute kann man per Google Street View dort durchfahren. Die Mehrzahl der Einwohner waren Deutsche. Die Umgangs- und Amtssprache im Ort war Deutsch. Ungarisch lernte man als Fremdsprache in der Dorfschule.
Einige wenige Nachfahren jener findet man noch heute dort. Einer davon hat es später in den USA sogar zum Millionär geschafft, angeblich gar nicht so weit entfernt von meinem Stammbaum. Es waren also nicht gerade die dümmsten.
Rossbrunn bestand aus einem Oberdorf und einem Unterdorf (aus diesem Tatbestand, den zwei Ortsteilen, entstand ein eigenes Lied, dessen Inhalt hier aufzuführen das Niveau dieses Textes zu weit absenken würde). Malerisch umgeben von Feldern und Wald, Wiesen und Wald und Feldern und einem Tümpel und Wald und Wald und – was weiß ich.
Dort gab es alles, was man (seinerzeit) zum Leben brauchte: einen Kindergarten, eine Schule, eine katholische Kirche, direkt gegenüber lag eines der drei Wirtshäuser inklusive Frisör, einen Friedhof hinter dem Gotteshaus, zwei Geschäfte, eine Schmiede, eine Tischlerei, ein paar weitere Handwerker und eine dorfeigene Feuerwehr. Und ringsherum erstreckten sich die Ländereien der Klein- und Großbauern.
Versorgt wurde sich größtenteils autark. Es gab alles Mögliche an Getier, was man so benötigte. Schnaps stellten die meisten selber her. Man lebte für damalige Verhältnisse so weit ganz gut und ungestört in Rossbrunn.
Und: Man feierte, was man feiern konnte. Heiratete jemand, war das gesamte Dorf eingeladen. Die Hochzeitsfeier verlief über volle drei Tage, von Freitag bis Sonntag. Heiratete gerade mal keiner, gab es genügend kirchliche Feiertage und weitere wichtige Anlässe.
Natürlich gingen die beiden Weltkriege nicht spurlos an Rossbrunn vorbei. Die dortigen Machthaber selber waren stets eifrig dabei, an der Seite der Deutschen mitzumarschieren. Im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, dessen Ausgang bekannt ist, durften sich diejenigen, die unter dem ungarischen Hitlerfreund Horthy direkt oder indirekt den ganzen Scheiß mitgemacht hatten, und diejenigen, die der Abstammung nach Deutsche waren, aus ihrer geliebten Heimat für immer verabschieden. Eine Racheaktion des von den Sowjet-Russen besetzten und überwachten neuen Ungarns, nun nicht mehr zur zerbrochenen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörend.
Januar 1948. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden alle Deutschstämmigen, die bis dato noch nicht selbst aus Angst vor den Russen oder vor Vergeltungsmaßnahmen geflüchtet waren, aufgefordert, Haus und Hof unverzüglich zu verlassen. Zu der Räumungsaktion rückten die russisch kontrollierten ungarischen Nachkriegskommunisten an. Alles wurde besetzt und beschlagnahmt. Mit dem, was sie am Leib hatten und auf einen Pferdewagen verfrachten konnten, wurden sie nach Zirc gebracht, dort in einen Güterzug verfrachtet und nach Deutschland verschickt.
Die Häuser, Gehöfte und Ländereien wurden entschädigungslos enteignet und unter den Neu-Ungarn verteilt. Das Gehöft meiner Großeltern mütterlicherseits ist aufgrund der nun folgenden rein-ungarischen „Pflege“ später völlig zerfallen.
Nur ein paar wenige Einwohner ohne Vermögen, die mit einer Ungarin oder einem Ungarn verheiratet waren oder deren ungarischen Namen angenommen hatten, durften bleiben. Die besser situierten Deutschstämmigen verloren urplötzlich alles.
Einige andere hatten sich bereits rechtzeitig vor dem Einmarsch der Rotarmisten aus dem Staub gemacht und sind direkt in den amerikanisch besetzten Teil Deutschlands abgewandert. Das waren letztendlich – in einer die Tatsachen verdrehenden und die Geschichte verfälschenden Weise – diejenigen, die nach 1989 von den Ungarn als die wahren „Vertriebenen“ gleichsam angehimmelt wurden. Diese waren im (später reichen) Westen Deutschlands gelandet und wohl was ganz Besonderes.
Erste Station eines der Sonderzüge in dem in vier Besatzungszonen unterteilten Deutschland war ein Auffanglager in Pirna an der Elbe im schönen Elbsandsteingebirge. „Ostzone“, zu den Russen – wieder! Oh Gott! Ein anderer Teil hatte mehr Glück, kam gleich direkt nach Passau.
Von diesen beiden Ausgangspunkten trennten sich die Bande der Vertriebenen: Die eine Gruppe wurde in Bayern sesshaft, wo schon die vorher freiwillig Ausgereisten lebten, der meinige war in Sachsen angelandet, letztendlich in der Oberlausitz.
Nach kurzen, aber wirkungsvollen Reibereien mit den alteingesessenen sächsischen „Platzhirschen“ verschafften sich die Neuankömmlinge schnell Respekt und Achtung. Dabei flogen auch schon mal die Fäuste. Eine Ohrfeige aus der Hand eines meiner Onkel konnte da durchaus einen gebrochenen Unterkiefer zur Folge haben. So viel dazu. Wie gesagt: Es waren zum Teil recht wirkungsvolle Auseinandersetzungen.
Seit dieser Zeit leben sie nun in großer Zahl, Familie, Verwandte und Bekannte, friedlich zusammen mit den Sachsen, mit den ebenfalls nach Kriegsende ausgesiedelten Schlesiern und mit denen, die noch so alle vertrieben wurden und in der landschaftlich idyllischen Oberlausitz dann eine neue Heimat fanden.
Die Mehrzahl der Ungarndeutschen hatte es binnen weniger Jahre erneut zu einem eigenen Haus gebracht und arrangierte sich nun mit dem gegebenen Umstand, dass sie nie mehr in ihre alte Heimat zurückkehren würden. War ja alles weg, wohin also? Wohl oder übel – sie blieben da.
„MAGUELA“ UND BEIM FRISÖR
Viel Neumodisches gab es für die Ankömmlinge in Sachsen zu erkunden. Wenn man vom Dorf in eine kleine Stadt kommt, hat das ein anderes Flair. Es gab im direkten Vergleich zu Rossbrunn erheblich mehr: zwei Kirchen, zwei Schulen, zwei Marktplätze mit zahlreichen Geschäften, mehrere Bäckereien und diverse Fleischer, wenigstens sechs größere Betriebe, eine Reihe an Gasthäusern und Bierstuben, Frisöre, die Polizeistation und, und, und … Sogar einen Entblößer, allerdings erst etwas später, zu meiner Kinderzeit.
Und da gab es auch ein paar Termini, die nur die Ungarndeutschen erfinden konnten oder in ihrer neuen Heimat ihrem Wissensstand entsprechend deuteten:
Sör nennt man in Ungarn bekanntlich das Bier. Da prangte doch auf dem Markt an einem Haus das Schild „Frisör“. Was kombinierte daraus einer der cleveren älteren Landsleute: Sör heißt Bier und die Silbe „Fri“ kann ja nur „frisch“ bedeuten. Sein Fazit: Hier gibt es „frisches Bier“. Er holte seinen Bierkrug von zu Hause und marschierte damit schnurstracks zum – Frisör.
Die Großmutter meines Cousins stritt sich im Lebensmittelladen bis aufs Messer mit einer Verkäuferin um „Maguela“. „Maguela“ kaufe sie immer hier und die Geschäftsfrau antwortete, dass es in dem Laden noch nie „Maguela“ gegeben hätte.
„Dees giabt’s jo neet“, wetterte die Oma, sie bestand auf dem Zeug, sie hatte es hier gekauft und wollte es haben!
Was um Himmels willen sollte das denn sein, „Maguela“?
Sie versuchte es der Verkäuferin in ihrem Slang zu erklären: „A schwoaza Schnops“ – ein schwarzer Schnaps.
„Gibt’s nicht“, war die hilflose Antwort.
Beide waren kurz vorm Verzweifeln. Das Muttchen wurde langsam böse, da sie annahm, man wolle ihr ihren Lieblingsfusel absichtlich vorenthalten. Sie wedelte schon mit ihrem Gehstock herum. Bis die Inhaberin selbst in den Verkaufsraum kam und sofort wusste, was die alte Dame immer kaufte: einen Likör, nicht „Maguela“, sondern „Mocca Edel“.
Für solche und viele weitere Amüsements sorgten die neuen Mitbewohner schon ab und an. Wenn wir als Kinder und Heranwachsende – bei welcher Gelegenheit auch immer – solchen Erzählungen lauschen durften, tat einem gelegentlich schon das Gesicht weh wegen des vielen Lachens.
Erst viel später sah man in Ungarn ein, welch fataler, großer Fehler mit der Vertreibung begangen worden war. Nach dem Zerfall des Ostblockes. Zu spät. Viele der Betroffenen waren verstorben.
Mein Großvater erhielt eine „großzügige“ Entschädigung für Haus, Hof, Stallungen, Pferde, Vieh und einige Hektar Land: satte zweitausend DM. Er wusste vor Schreck gar nicht, wohin mit soooo viel Geld.
Ein anderer Ungar hat – mit Zeitverzögerung – Ende der achtziger Jahre viel gut gemacht: Gyula Horn, der damalige Ministerpräsident, hatte es erkannt, als er am 27. Juni 1989 Seite an Seite mit seinem österreichischen Amtskollegen Alois Mock der pervertierten Sozialismuskreatur den Hals durchschnitt: besser gesagt, den Stacheldraht an der Grenze zwischen diesen beiden Nachbarländern.
Das war ein „Dolchstoß“ in Erich Honeckers Herz, trotz alledem hatte dieser selbst im August 1989 noch solche Geistesblitze geäußert wie: „Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.“ Selbst bei seinem „Abschiedssingsang“ am 7. Oktober 1989 träumte er von seiner hundertjährigen Mauer, als ihm Gorbatschow das geschichtliche Bein in den Weg stellte.
Aber gut, dazu später mehr. Erst mal zurück ins Jahr 1962.