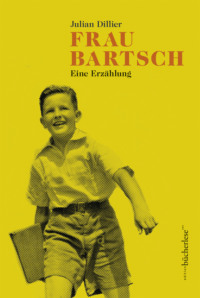Buch lesen: "Frau Bartsch"

Julian Dillier
FRAU BARTSCH
Eine Erzählung

Inhalt
Vorwort
Im Schatten der Dorfkapelle
Angeheuert
Residenz
Trinklä
Jugendland
Autoritäten
Geheimnisse
Gesprächsstoff
Meebesseri
Schwester Leonardina
Der Tod
Sünden
Heimat
Fronleichnam
Staatskunde
Rathaus
Weihnachten
Theater
Ein Kind von Bruder Klaus
Epilog
Glossar
Vorwort
Wir blicken in die Zeit der 1930er-Jahre, auf eine kleine, in sich ruhende Welt: Sarnen im Kanton Obwalden. Hier steht die Kirche noch mitten im Dorf. So eine Kirche leuchtet fürsorglich übers ganze Dorf, und sie ist in Gestalt des Herrn Pfarrers und im Takt ihrer hohen Feiertage eine heilige Autorität. Mit zwei anderen, schwächeren, bildet sie ein Dreigestirn: Da ist die politische Autorität mit den hohen Herren im Rathaus, und da ist die pädagogische mit dem in Staatskunde beschlagenen Herrn Lehrer der Dorfschule und den Professoren des altsprachlichen Kollegiums.
Im Schatten der Dorfkapelle Maria Lauretana schlummert eine alltägliche, in ihrer Art aber nicht minder anmutige Einrichtung: Es ist der Merkur-Laden einer gewissen Frau Bartsch. Als einstige, nunmehr verwitwete Offiziersgattin bringt sie aus Dresden den Duft der weiten Welt in den ländlichen Flecken Sarnen. Der blitzsaubere Eingang und eine gut assortierte Schaufensterauslage adeln ihr Kolonialwarengeschäft zu einem vornehmen Salon, dem die Gattinnen von Juristen und höheren Beamten ihre Aufwartung machen und den feinsten Kaffee, die beste Schweizer Schokolade und die zartesten Biskuits kaufen. Frau Bartsch ist stets adrett gekleidet, und so wähnen sich ihre Besucher mehr als Gäste denn als Kunden. In ihrer andachtsvollen Geschäftigkeit pflegt die weltläufige Heimkehrerin mit ihren Gästen nämlich einen distinguiert-vertrauensvollen Umgang, der darüber hinaus im Fall der redseligen und scharfzüngigen Rathaus-Kanzlistin Anni Seiler zu einer mitunter geheimnisträchtigen Vertraulichkeit reift. Allein, Frau Bartsch ist stets darauf bedacht, Anstand und Sittlichkeit zu wahren und einfältigem Gerüchtebrauen und unrühmlichem Geheimniskrämern beherzt entgegenzutreten.
Im Merkur-Laden findet das Dorfleben sein Echo. Im Frühling erfüllen Gespräche zur Landsgemeinde den Raum, Ostern erlebt seine Auferstehung auf den Ladengestellen und die köstlichen Weihnachtsgeschenke stehen dem Gabentisch des Schützenfestes in nichts nach. Frau Bartsch, ebenso geschäftstüchtig wie kunstsinnig, bietet alles so weihevoll feil, dass es an die Verrichtungen an einem Altar gemahnt. Wie die Kirche mit ihrer liturgischen Ordnung das Heilige in den Alltag einführt, so besitzt Frau Bartsch die Gabe, dem Alltäglichen die höhere Weihe des Sonntäglichen zu verleihen.
In diese ebenso kleine wie weite Welt tritt eines Tages der zehnjährige Ich-Erzähler, indem er als Ladenhilfe und Botengänger anheuert. Vor seinen Augen entfaltet sich das Wirken und Weben eines vielfältigen Figurenkabinetts, er hört von Angelegenheiten, die Erwachsene als «frivol» und «scandaleux» abkanzeln, von der Kanzlistin, die mit ihren Seidenstrümpfen das ganze Rathaus durcheinanderbringe, dass eine schöne Handschrift der Schlüssel für den Staatsdienst sei und «in der Schule deshalb auswendig gelernt werden» müsse, «weil die Kinder nicht zum Denken erzogen werden dürfen». Wenn das keine Gebrauchsanweisung fürs Erwachsenwerden ist!
Mit dieser autobiographischen Erzählung entführt uns Julian Dillier mit rührender Feinsinnigkeit in seine Kindheit im Hauptort von Obwalden. Es ist ein Erinnerungsstück an die 1930er-Jahre, gezeichnet in einer anekdotenhaften Leichtfüssigkeit, grundiert mit einem liebevollen Heimatsinn und umrahmt von einer altersweisen Genügsamkeit.
Vielleicht ergeht es Ihnen wie mir, und Sie sind versucht, am stillen Dorfplatz im Schatten der Dorfkapelle nach dem kleinen Tempel jener grossen Dame Ausschau zu halten und weiteren Geschichten aus dem Land «ob dem Wald» zu lauschen. Mit etwas Glück entdeckt man vor Ort eine eigene Figur wie Frau Bartsch, eine höchstpersönliche «Lichtgestalt mit zugehöriger Lehranstalt».
Heute, im Februar 2022, wäre der Schweizer Mundartautor Julian Dillier 100 Jahre alt geworden. Frau Bartsch aus dem Jahr 1989 ist sein einziges Prosastück und wird zu seinem Geburtstag neu aufgelegt.
Sachseln, im August 2021
Marc von Moos
Im Schatten der Dorfkapelle
Auch ein Dorf kann schlafen. Es liegt da wie mit geschlossenen Augen, etwa am frühen Morgen. Die Geschäfte mit heruntergezogenen Rollläden. Der Dorfbrunnen steht in leisem Dunst. Einige Frauen, auch Klosterfrauen, huschen in die Dorfkapelle, in der Allee des Frauenklosters raschelt es im Laub. Wenn man in der Frühmesse ministrieren muss, begegnet einem vielleicht ein frühes Fuhrwerk oder es fällt ein Lichtschimmer auf die Strasse aus dem Stall der stummen Fangers, die die Kühe melken und das Vieh mit Heu versorgen. Das Dorf erwacht erst gegen acht Uhr.
Der Gottesdienst in der Kapelle ist zu Ende. Nach diesem Gottesdienst öffnen die Geschäfte, rattern die Rollläden hinauf und da erscheint Frau Bartsch mit dem Besen vor dem Laden. Wenn sie herauskommt, schliesst auch der Konditormeister Spichtig gähnend seine Konditorei auf. Zuvor bindet er sich immer eine saubere weisse Schürze um. Ein Zeichen für Vater Hurni, seinen Laden gegenüber der Post wie zur Markierung zu umschreiten und einen Blick in seinen Garten zu werfen. Unversehens springen in diesem Augenblick aus dem Uhrenladen Imfeld zwei Mopse ins Freie, beschnuppern das Trottoir nach Neuigkeiten, keuchend und mit kurzem Atem, und bezeichnen mit hochgestrecktem Bein ihren Besitz an der Hauswand.
Frau Bartsch, die Inhaberin des Merkur-Ladens im Schatten der Dorfkapelle, widmete die erste Verrichtung des Tages der Sauberkeit um ihren Laden. Für sie war ein blitzsauberer Eingang, zusammen mit einem gepflegten Schaufenster, eine Einladung, sie in ihrem Kolonialwarengeschäft zu besuchen. Sie empfing jeden Kunden wie einen Gast. Sie kleidete sich auch immer so, als ob sie ihre Kunden wie Gäste behandeln wollte. Als Bub fiel mir dies auf. Andere Frauen im Dorf trugen schmucklose, graue Berufsschürzen, sie hingegen war stets sehr adrett angezogen.
Frau Bartsch war eine sehr gepflegte Frau. Mich dünkte, sie wirke immer gleich alt. Weil sie die fünfzig schon überschritten hatte, gehörte sie in meinen Augen bereits zur älteren Generation. Zu jener Generation, die gerne erzählte, wie früher alles besser war, gesitteter und vornehmer. Weil Frau Bartsch das Wort «vornehm» recht gerne in den Mund nahm, verglich ich sie heimlich mit einer der adligen Frauen, wie sie mir in den Romanen begegneten, die ich mir heimlich vom kleinen Büchertischchen der Mutter stibitzt hatte. Es ging in diesen Romanen auch gar üppig zu und her mit Liebschaften in Adelskreisen.
Frau Bartsch hatte etwas an sich, das mich an solche Kreise mahnte. Sie trug durch ihre Heirat mit einem Internierten aus sehr gutem Haus in Dresden einen deutschen Namen, hatte kurze Zeit in Deutschland gelebt und war nach dem Tode ihres jungen Mannes in ihre liebe Obwaldner Heimat zurückgekehrt. Als junge Witwe übernahm sie mitten im Dorf einen kleinen Merkur-Laden.
Und dieser Laden hatte es in sich. Das war nun nicht irgendein Kolonialwarenladen, sondern ein Geschäft, in dem man mit ausgesuchter Höflichkeit bedient wurde. Frau Bartsch redete ihre Kunden mit Sie und nicht mit Iär an, verabschiedete ein Ehepaar nicht mit Adie midänand, sondern Adie beidersyyts. Sie behandelte ihre Kunden nicht nur sehr zuvorkommend, sie war auch darauf bedacht, ihnen den feinsten Kaffee, die beste Schweizer Schokolade und die zartesten Biskuits zu verkaufen. Und wie sie verkaufte! Das war alles so liturgisch weihevoll, dass es mir vorkam wie Verrichtungen an einem Altar. Da Frau Bartsch beinahe jeden Tag ein anderes Kleid trug, war ihre Arbeit immer so sonntäglich. Mir schien, sie verstehe ihren Laden wie einen vornehmen Salon und die Kunden würden stets eine andere Redeweise annehmen, wenn sie in ihr Geschäft kamen. Sie war stets angezogen wie an einem Sonntag. Ich war darum erstaunt, wenn sie für ihren Kirchgang noch sonntäglicher aussah. Dann trugen sie und ihre zwei Schwestern, Theres und Hilda, helle, luftige Roben, mit wunderbaren Rüschen, Bändern und Maschen geschmückt. Sie sahen aus wie festlich verpackte Bonbonnieren. Man sah die drei Schwestern immer beieinander, wenn sie zur Kirche gingen.
Mit Vorliebe erfüllten sie ihre Sonntagspflicht in der Klosterkapelle von St. Andreas. Dort fanden sich gerne jene ein, die sich zur gehobenen Gesellschaft der Residenz zählten: die Leute vom Roten Haus, die Stockmanns, Imfelds und Gattinnen von Juristen und höheren Beamten. Sie sassen und knieten in ihrem Chremmli, in reservierten Betstühlen, die ihnen die Klosterfrauen vermietet hatten. Damit bekamen die vornehmen Sarner Damen und Herren das Gefühl, sie unterstützten mit ihrem Kirchgang auch noch das Kloster.
In der Residenz hatte eben jede Schicht ihr Gotteshaus. Die vom Unterdorf und von Bitzighofen, die kleineren Handwerker, besuchten mit wenigen Ausnahmen die Sonntagsmesse um zehn im Kapuzinerkloster. Die grosse und festliche Pfarrkirche auf einer schönen Anhöhe besuchte man nur dann, wenn es galt, gesehen zu werden, etwa an Festtagen, wenn der Gottesdienst mit einem feierlichen Hochamt, mit Chor und Orchester, gefeiert wurde und wo der Landammann mit dem Landweibel in vollem Ornat in den Ratsherrenstühlen anwesend war. Im Ratsherrengestühl versammelten sich alle Honoratioren in festlichem Schwarz, feierlich erhöht.
Da die jüngste Schwester von Frau Bartsch, die zierliche, etwas rundliche Hilda, über einen prächtigen Sopran verfügte und musikalisch geschult worden war, sang sie im Chor die Solopartien. Dies war der Grund, weshalb die Schwestern an solchen Festtagen den Gottesdienst in der Pfarrkirche besuchten. Mit sichtlichem Stolz setzten sich Frau Bartsch und Theres in eine Kirchenbank im vorderen Teil der Kirche, weil die Akustik auf diesem Platz besser sei. So könne die Wirkung des Gesangs besser wahrgenommen werden. Ein solch festlicher Sonntag wirkte im Geschäft der Frau Bartsch nach, waren doch die Darbietungen des Chores, besonders der Hilda, eine Woche lang das Hauptthema. Mit einer unwahrscheinlichen Fantasie verstand es Frau Bartsch, die Ladengespräche auf das sonntägliche Konzert in der Kirche zu lenken. Beim Verkauf einer Frigor-Schokolade verglich sie den Schmelz dieser Schokolade mit dem Schmelz eines fraulichen Soprans in der Kirche. «Ach ja», meinte dann die Kundin, «Ihre Schwester Hilda hat doch wunderbar gesungen.» Geschmeichelt und mit gekünstelter Überraschung erwiderte darauf Frau Bartsch: «Sie meinen das ‹Agnus Dei› vom letzten Sonntag in der Pfarrkirche? Gewiss, sie war bei sehr guter Stimme, und ihr Gesang fand viel Beifall. Ja, ja, unsere Hilda nimmt es sehr ernst mit ihrer Musik.» Die kleine Bemerkung ihrer Kundin gab ihr Gelegenheit, mit überlegener Distanz, aber mit genügend Hochschätzung von der Gesangskunst ihrer Schwester zu berichten.
Angeheuert
Dass mich diese Frau eines Tages als Ladenhilfe für alles angestellt hat, ist mir heute noch ein Rätsel. Ich sei ein manierlicher und freundlicher Bub, hat sie mir attestiert. Ich erzählte meinen Schulkameraden, dem von Wyl Walter, dem Beck Ruedi und dem Dillmann Seppi, von dieser Neuigkeit und brauchte dabei grossmäulig das Wort «anheuern». Damit wollte ich die Anstellung etwas schmackhafter machen. Zudem hat mir das Wort «anheuern» sehr gut gefallen. Ich hatte es in dem Abenteuerroman «Rodrigo, der Schiffsjunge des grossen Kolumbus» von Helene Pagés gefunden. Und so heuerte man uns zu jeder Arbeit an. Man wurde angeheuert für den Garten des Vaters, fürs Heuen, aber auch für die Küche.
Mit diesem Anheuern gab ich meinen Kameraden zu verstehen, dass es sich um eine für Buben achtbare Arbeit handle, weswegen sie mich nicht von den verschiedenen Spielen auf dem Landenberg, im Eywald oder am See ausschliessen dürften. Ich war schliesslich auf ihr Ansehen angewiesen, denn sie gaben den Ton an. Ich bewunderte sie, verehrten sie doch auch gleichaltrige Mädchen, das hübsche Bethli Rennhard, die gwirblige Anni Voteri mit ihrem italienischen Temperament. Sie gingen nicht umsonst mit Vorliebe zur Maiandacht ins Frauenkloster und flanierten in lauschigen Mainächten in der Klosterallee. Wenigstens vermutete ich das und fand es ungeheuer spannend. Ich wusste nämlich, dass heimliches Getue zwischen Buben und Mädchen in der Allee des Frauenklosters bei Schwester Leonardina als gottsträflich galt. Und was Schwester Leonardina, die strengste Lehrschwester der Eidgenossenschaft, verurteilte, war für uns Gesetz und Ordnung.
Die Schwester hatte ein generalhaftes Auftreten, verfügte über die Stimme eines Feldweibels und hatte eine Handschrift, die sie recht oft mit ihrem Tatzenstock unterstrich. Wen Schwester Leonardina körperlich massregelte, den strafte sie wie ein rächender Engel. Sie hatte ihre ganz bestimmte Strafliturgie. Sie liess den Delinquenten vortreten, befahl ihm, mit dem Gesicht zur Wandtafel zu knien und hielt eine Strafpredigt. Dann mussten alle Schüler den Kopf auf den Tisch in die verschränkten Arme legen. Sie befahl, die Augen zu schliessen, und dann versetzte sie dem armen Sünder mit ihrem breiten, harten Tatzenstock einige mannstarke Schläge auf den Hintern. Nach einer solchen Exekution mussten wir für den Sünder noch ein Vaterunser beten.
Nicht umsonst war Schwester Leonardina, sie hätte eine Generalstochter sein können, gefürchtet wie ein Polizeiwachtmeister. Sie war auch zuständig für die Massregelung renitenter Ramersberger Lausbuben. Weil weder Ruedi Beck, Josef Dillmann noch Walti von Wyl diese Schwester angemessen respektierten, genossen sie in der Klasse eine unbeschränkte Herrschaft, an die auch ich mich halten musste, zumal ich mich mit meiner Schüchternheit nie recht wehren konnte. Ich war eher unterwürfig wie ein kleines Hündchen. Umso mehr erfüllte es mich mit Stolz, dass mich Frau Bartsch angeheuert hatte.
Sie gab mir zu verstehen, dass ich jeweils zuerst die Hausaufgaben machen solle und dann etwa zwei bis drei Stunden kleinere Botengänge und Arbeiten im Laden und im Keller verrichten könne. Lohn gab sie mir keinen. Geld sei für Buben schädlich, meinte sie, aber jeden Abend nach Ladenschluss füllte sie mir einen Papiersack mit günstigem Konfekt, das offen in grossen Konfektbüchsen zum Verkauf lag. Durch ein Glas, das über die Blechschachtel gestülpt werden konnte, sah man die Süssigkeit, und im Glas eingeklemmt stand auf einer weissen Etikette der Preis. Schön der Reihe nach standen diese Konfektbehälter im Gestell, von den billigen bis zu den teuren Sorten. Ich bekam meistens von der billigsten Sorte. Aber ich liebte dieses Konfekt. Es waren kleine Waffeln, oft auch Petit Beurre und Mäiländerli. Damals kosteten hundert Gramm dieser Sorte fünfundzwanzig Rappen, die teuersten Biskuits aber bereits gegen einen Franken. Den Sack voller Biskuits trug ich nach Hause und gab ihn der Mutter, die das Konfekt uns Geschwistern verteilte. So kamen wir jeden Tag zu unserer Süssigkeit, was unsere Tante Jakobee erzieherisch nicht gut fand. Jeden Tag eine Süssigkeit versaure das ganze Leben, pflegte sie zu sagen und riet der Mutter, die vielen Biskuits für den Sonntag aufzubewahren. Ja, hie und da hatten wir Buben schon das Gefühl, in unserer Stube habe nicht die Mutter, sondern die Tante Jakobee das Sagen. In ihrer Familie war sie die Älteste und meine Mutter die Jüngste, die als Nesthäkchen besonderer Aufsicht bedurfte.
Residenz
Ein Dorfladen hat seine ganz bestimmten Stammgäste. Bei Frau Bartsch waren das vorwiegend Frauen. Eine Kundin ganz besonderer Prägung war die Kanzlistin Anni Seiler. Sie verkörperte für mich das Rathaus. Sie war beredt, wusste über alles Bescheid und versorgte Frau Bartsch mit Nachrichten aus dem Rathaus. Sie hielt sehr viel auf das Amtsgeheimnis. Von geheimen Dingen vernahm Frau Bartsch nichts. Das hätte sie auch nicht interessiert. Hingegen waren persönliche Eigenarten der Herren im Rathaus gefragt; kleine Vorkommnisse, die diese Herren etwas menschlicher machten. Anni Seiler war damals das einzige Frauenzimmer im Rathaus. Für Frau Bartsch war sie weniger eine Respektsperson als vielmehr eine Repräsentantin sarnerischer Vornehmheit. Anni stammte aus sehr gutem Haus. Ihr Vater war Gerichtspräsident, ihre Familie war eine Hoteliersfamilie und betrieb die Pension Seiler, in der früher deutsche Familien aus Adelskreisen logiert hatten. Dieser Hauch adliger Vornehmheit duftete auch in den hübschen Kleidern der Anni Seiler. Sie war lebhaft interessiert an der Politik. Deshalb haben mich die Gespräche zwischen ihr und Frau Bartsch schon als Bub stets fasziniert.
Anni Seiler ging nie zur Kirche. Darum haftete ihr eine Art Verruchtheit an, eine Mischung von Anderssein und Widerstand. Dasselbe bewunderte ich und ängstigte mich auch bei zwei andern Dorfbewohnern, von denen man hinter vorgehaltener Hand flüsterte, man sähe sie nie in der Kirche. Es waren das der Kupferschmied-Päuli in der Rathausgasse und der Tabakhändler Portmann am Dorfplatz. Mir fiel auf, dass alle drei in unmittelbarer Nähe des Rathauses wohnten oder arbeiteten. Anni auf der Kanzlei des Rathauses, der Kupferschmied-Päuli betrieb an der Rathausgasse eine Kupferschmiede, und der Portmann verkaufte Tabak am Dorfplatz. Keiner von ihnen ging in die Kirche. Und keiner hatte dafür eine Entschuldigung. Im Gegenteil, sie prahlten damit. Portmann nannte das Mut, anders zu sein als alle andern, der Kupferschmied-Päuli polterte, je näher man bei einem Rathaus wohne, umso weniger glaube man. Anni witzelte einmal im Laden, der Kirchgang sei für viele Sarner nur ein Umweg in die Dorfbeiz.
Als Bub war ich stolz auf unsere Residenz. Zwar erklärte uns Lehrer Gisler, Sarnen sei keine Stadt, nur ein Flecken. Man rede auch vom Flecken Altdorf und vom Flecken Stans. Eine Stadt sei ein Ort nur, wenn er ein festes Stadtgefüge habe, mit Mauern, Türmen und Häuserreihen. Früher hätten Fürsten und Könige Stadt- und Marktrechte verliehen. Die Urkantone seien immer reichsunmittelbar regiert worden. Und so sei ein Flecken ganz anders entstanden.
Mit seinem Geschichtsunterricht wusste Lehrer Gisler uns einen richtigen Sarner Stolz zu geben. Mir war Sarnen ganz besonders lieb, weil es mir vorkam wie eine Frau, die bei jeder Jahreszeit andere Kleider und andere Accessoires trägt und sich möglichst vielfältig gibt. Wintertage im Dorf und an den Dorfrändern, auf dem Landenberg, am Eywald, im Ried im Unterdorf, an der Melchaa muteten immer weihnächtlich an. Es duftete aus allen Häusern nach Backwerk, die Fuhrwerke fuhren wie auf leisen Sohlen über das Dorfpflaster, die Wälder rings um das Dorf waren silbrig und verschlafen, und der Schnee verwischte die harten Konturen der Dächer. In winterlichen Tagen wirkte alles so geheimnisvoll. Wir fieberten auf den Sankt Nikolaus, auf Weihnachten, auf die Ferientage.
Jede Jahreszeit hatte ihre ganz besonderen Zeichen, die es nur in dieser Jahreszeit gab. Niemandem wäre es eingefallen, Schänkäli und Chilbichrapfä ausserhalb der Chilbizeit zu backen oder zu verkaufen. Und wenn der Frühling kam, begann das Politisieren in den Häusern, denn es ging auf die Landsgemeinde zu. Und so ein Vorabend vor der Landsgemeinde! Da schien es, Sarnen putze sich heraus, erwarte Besuch und gebe sich besonders städtisch. Ein Jahr ohne einen Landsgemeindesonntag wäre mir vorgekommen wie ein Jahr ohne Ostern. In der Woche davor durften wir Buben bei Frau Christen im Heimatmuseum die Kostüme holen für die Hälmiblääser. Die zogen sich am Landsgemeindesonntag bei uns in der Landweibel-Wohnung um. Frau Christen hütete diese Kleider sorgfältig und packte sie behutsam wie Kleinode in einen grossen Wäschekorb. Sie kam uns überhaupt vor wie ein Museumsstück. Sie gehörte zum Museum wie die Kanonen im Parterre, wie Fronleichnam und die Sarner Aa zum Sommer.
Die Aa war uns ein Spielgefährte. Und zur Sarner Aa gehörte auch der Schwiibogen, der das Dorf mit Kirchhofen verband. Da hockten wir auf dem niederen Brückenmäuerchen und staunten in die Aa hinunter, wo sich die Fischwelt tummelte, und mir war, ich segle dabei wie auf einer Wolke über dem Sarnertal. Der Schwiibogen bot uns noch eine andere Abwechslung: dann, wenn der «Kronen»-Leo auf einer schwankenden Leiter zur Brückenlampe hochkletterte und diese mit einem schwarzen Tuch versah, damit er mit seinen Fischerkollegen dem Laichfang frönen konnte. Dem «Kronen»-Leo waren Fischerei, Jagd und das Motorrad viel wichtiger als seine «Krone». Die überliess er seinen Serviertöchtern. Bei seinen Tätigkeiten hatte er selten Glück. Einige Male verunfallte er schwer, weshalb er sein Gehör beinahe ganz verlor. Darum war er gewohnt, im Gespräch eine Hand wie ein Hörrohr an das rechte Ohr zu halten. Mit der anderen Hand stützte er den Ellenbogen, und diese Haltung war so ausgeprägt, dass man sich den «Kronen»-Leo nie anders hätte vorstellen können. Und weil er bei solchen Gesprächen nicht immer alles verstand, pflichtete er seinem Gesprächspartner mit den stets gleichen Worten bei: «Mäinäid scheen, mäinäid scheen…»
Neben der Aa war es der Studententeich, der uns an den See lockte. Droben im Studententeich bastelten wir uns ein Floss, liessen es dann die Sarner Aa hinuntergleiten, banden es bei der Rathausstiege an, und von diesem Tage an benutzten wir die Aa als unseren Fluss- und Wasserweg in die dörfliche Badeanstalt. Zum Sommer gehörte ebenso unser Bademeister Niklaus Heimann, gehörten das Schilfufer und das Gequake der Frösche, aber auch die stillen Sommerabende am See.
Wenn dann der Herbst die Blätter in der Allee beim Frauenkloster färbte, wenn es so wundersam neblig wurde in den Gassen und wir durch das gefallene Laub schlurfen konnten, wenn Doktor Diethelm die Strassenarbeiter die Ruhebänklein des Verkehrs- und Verschönerungsvereins versorgen liess, witterten wir Buben bereits unser Bubenschiessen, und dann war der Kaiser Louis der wichtigste Mann im Dorf – der Kaiser Louis und die Ehrenmänner beim Ehrenmänner-Stich. Sarnen wurde mir zum Dorf der Jahreszeiten. Hier erlebte ich sie wundersam wie einen reichen, bunten Bilderbogen.
Die Jahreszeiten spiegelten sich auch beim Laden der Frau Bartsch. Im Herbst war sie öfters mit dem Besen vor der Haustüre, denn der herbstliche Wind wehte ihr das Laub von den Lindenbäumen bei der Dorfkapelle aufs Trottoir, auch gab ihr das Laub aus Hurnis Garten Arbeit. Hurnis Garten, eine kleine Wildnis mitten im Dorf, mutete an wie eine andere, sorglose Welt. Als Kind glaubte ich immer, der liebe Gott habe in diesem altertümlichen Garten seine ersten Versuche zur Erschaffung der Welt gemacht.
Es gab aber auch eine Jahreszeit, in der ich meinte, Frau Bartsch wolle ihren ganzen Laden umstellen. Nach den anstrengenden Weihnachtstagen standen leere Kisten herum, da türmte sich die Holzwolle im Hausgang, da leerten sich die Gestelle, da lag das festliche Packpapier herum, und da bekam ihre grosse Ordnungsliebe den Anstoss, alles zu verändern, neu aufzustellen. Sie liess mich auf die Bockleiter klettern, diesen und jenen Artikel herunterholen, umstellen, und selbstverständlich wurden dabei die verschiedenen Gestelle fein säuberlich abgestaubt. Der Staub war für sie das Hässlichste im Laden.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.