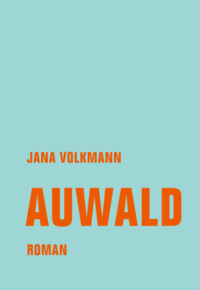Buch lesen: "Auwald"
Judiths Lieblingswort ist Akribie: Sie ist Tischlerin, und was sie mit den Händen herstellt, gelingt. Holzarten erkennt sie am Geruch. Menschen dagegen sind ihr ein Rätsel. Ob Silvester in Berlin oder ein Sonntagsfrühstück in Wien mit ihrer Freundin Lin – nie ist sie so einsam wie in Gesellschaft anderer. Dann steigt sie allein auf ein Schiff und alles verändert sich. Ein Ereignis, das andere als Katastrophe bezeichnen würden, ist für Judith die beste Gelegenheit, von vorn anzufangen. Zwischen Wien und Bratislava spielt dieser Roman über die Schönheit des Zufalls, über Einsamkeit – und über Komplizenschaft.
Jana Volkmann, geboren 1983 in Kassel, lebt als freie Autorin und Journalistin in Wien. Sie studierte in Berlin Europäische Literaturen und arbeitet derzeit an einer Dissertation über Hotels in der Gegenwartsliteratur. Sie schreibt Essays und Literaturkritik u. a. für den Freitag, Tagebuch, neues deutschland und den Standard. Zuletzt erschienen »Das Zeichen für Regen« (Roman, 2015) und »Fremde Worte« (Erzählung, 2014) in der Edition Atelier. Mit der Kurzgeschichtensammlung »Schwimmhäute – 26 Metamorphosen«, Edition Periplaneta, hat sie 2012 ihr literarisches Debüt gegeben.
JANA VOLKMANN
AUWALD
ROMAN

Die Recherche für den vorliegenden Roman wurde durch das Bundeskanzleramt Österreich, Sektion II Kunst und Kultur mit einem Reisestipendium unterstützt.
Erste Auflage
© Verbrecher Verlag 2020
Satz: Christian Walter
ISBN 978-3-95732-446-7
eISBN 978-3-95732-461-0
Der Verlag dankt Olanike Famson, Nora Gerken und Florin Schwald.
»So wurde der Mensch, beim Durchgang durch die Höhle, das träumende Tier.«
Hans Blumenberg, Höhlenausgänge
»wir lieben uns mit letzter kraft ans ufer«
@lovebot7000
INHALT
PROLOG
Wurmlöcher
Krähenfrühstück
Mitternacht
Momentum
Kaiserinnenreich
Secunderabad
Es war also Tag
Pix Fagi
Cremona
My oh my
Terra inviolata
II
Ich
Villain, I have done thy mother
Auwald
Oh, welch Ungemach
Alte Fehler
Körperproblem
Oliven
Ribisel
Das teuerste Auto der Welt
Tanken
Windfrei
Gut trainierte Cousins
Marianna
Biber im Gemäuer
EPILOG
Anmerkungen
Dank
PROLOG
Die feuchte Leere strich wie etwas Lebendiges über Judiths Rücken. Von außen wirkte der Tunnel reglos und stumm. Dabei hörte Judith ihn immer mehr, je länger sie darin saß. Manchmal huschte hinter ihr etwas durch die Schwärze, es ratterte und klapperte tief im Inneren, gluckste und gurgelte. Die Geräusche von außerhalb traten dagegen immer weiter in den Hintergrund, so dass sie sie kaum mehr wahrnahm, wenn sie sich nicht ganz darauf konzentrierte. Ihr war klar, dass dies nur ein zweitklassiges Versteck war. Ein Spürhund müsste mit seiner Nase nur einmal nah genug an den Tunneleingang kommen, und schon wäre ihre Tarnung in der Dunkelheit dahin.
Und sie hatten Hunde, jede Menge sogar. Judith hörte sie manchmal bellen, hörte die klaren, abgehackten Rufe ihrer Befehlshaber. Besonders weit weg klangen sie nicht, aber hier drinnen hörte sich ohnehin alles anders an, das Echo machte es schwer, Distanzen einzuschätzen. Nichts war mehr sicher, auf die Sinne am wenigsten Verlass. Kurz nachdem sie ihre Position gefunden hatte, gerade so tief in der Röhre, dass sie den Eingang noch klar im Blick hatte, tauchten zwei Menschenbeine vor dem Tunnel auf, liefen vorbei, kamen wieder zurück. Von den Steinwänden hallte ihr Herzschlag wider, zumindest kam es ihr so vor. Die Beine gehörten einem Mann, der nun in die Hocke ging, in den Tunnel hineinschaute, mit einer Taschenlampe um den Eingang herum leuchtete, als hätte er bloß seinen Autoschlüssel verloren. Judiths Blut rauschte in ihren Ohren. Der Schein der Taschenlampe kroch an der Tunnelwand entlang auf sie zu, dann ging das Licht aus, und die Menschenbeine liefen wieder davon.
Judith saß auf einem erhabenen Stein, hatte ihren Rucksack in eine etwas weniger feuchte Nische gequetscht und beobachtete, wie der helle Tunneleingang sich immer weniger vom dunklen Drinnen abhob. Eigentlich hatte sie vorgehabt, die Zeit zwischen Tag und Nacht für ihren Aufbruch zu nutzen, den Moment, in dem sich die Suchtrupps an neue Gegebenheiten anpassen mussten, Scheinwerfer aufstellten, sich für die Dunkelheit rüsteten, weil selbst an einem Tag wie diesem die Sonne ihren Gewohnheiten nachging. Aber dann zögerte sie so lange, dass der Augenblick verstrich und es richtig Nacht wurde. Selbst im Tunnel machte es einen Unterschied, wie spät es war; die nachtaktiven Tiere versetzten ihn in eine geschäftige Unruhe, vor lauter Zirpen und Schwirren vibrierte die Luft.
Sie griff in den Stoffbeutel, der noch immer über ihrer Schulter hing, und machte Inventur. Dreieinhalb Müsliriegel, eine Tüte Studentenfutter, eine beinah volle Flasche Wasser und eine Banane, die sie am Morgen noch in Wien eingepackt hatte. Sie entschied sich für die Banane. Beim Essen fiel ihr auf, wie hungrig sie war. Sie lauschte in sich hinein, ob da noch etwas anderes war. Erschöpfung, Furcht, Sehnsucht oder Reue. Nichts zu spüren, nur die Knie taten ihr etwas weh. Vorsichtig tastete sie sich ein Stück tiefer in den Tunnel, um eine neue Sitzgelegenheit zu finden. Statt zu schlafen, rief sie sich das letzte Bild vor Augen, das sie beim Einstieg in den Tunnel gesehen hatte. Hundert, vielleicht hundertfünfzig Meter weiter war die Brücke, gesichert mit Betonblockaden, auf der zig Polizisten standen und ins Wasser starrten, als würden sie fest damit rechnen, dass die verschwundene Fähre ganz von allein aus den Tiefen des Flusses auftauchen würde, wenn sie nur lang genug hinschauten. Wahrscheinlich wussten sie einfach nicht, wohin sie sonst gucken sollten. Am anderen Ufer gingen Taucher an Land, und dann waren da die Hubschrauber, die Drohnen. Zum Glück hatten sie alle etwas Besseres zu tun, als nach Einer zu suchen, die nach ein paar Stunden außerhalb der Zivilisation bereits wie eine Landstreicherin roch und bestimmt auch so aussah. Sie fühlte sich schon ganz verfilzt. Und was machte sie jetzt mit der Bananenschale: das Naheliegende. Sie verlor sie, ganz einfach war das hier drin.
Als ganz in der Nähe ein Hubschrauber rotierte und sie sich traute, im Lärm ihre Stimme auszuprobieren, fielen ihr zuerst keine richtigen Worte ein. Dann flüsterte sie ein paar Holznamen. Erle, Eibe, Douglastanne. Hier drin klang alles wie eine Zauberformel. Unter ihren Worten flirrte der Raum. Judith betrachtete den Eingang der Höhle, vor dem alles getan wurde, um die Nacht mit Hilfe von künstlichem Licht auszutricksen. Mal flackerte es, wurde heller und wieder dunkler, ging mal mehr ins Gelbe und mal mehr ins Blaue. In Wellen drangen Geräusche herein, die jetzt nicht länger als einzelne auszumachen waren, sondern wie ein Schwarm Insekten nur im Ganzen funktionierten. Offensichtlich waren die Suchtrupps noch immer nicht erfolgreich gewesen. Nicht einen Moment wollte Judith die Augen von dem runden Loch abwenden, ihrem einzigen Fixpunkt hier im Nichts. Wie viel Zeit verging, versuchte sie mit Hilfe der Geräusche abzuschätzen, je nachdem, ob sie Tagtiere oder Nachttiere hörte, aber je länger sie der Welt fernblieb, desto schwerer fiel es ihr, sich ein Urteil über sie zu machen. Außerdem konnte sie die Zeit anhand ihres Hungers und der verbleibenden Vorräte messen. Abgesehen vom Wasser würde alles noch eine ganze Weile reichen, sicherlich länger als notwendig. Aber sie sah sich einfach nicht die feuchten Wände ablecken oder aus den Lacken trinken, die sich zwischen den Steinen am Boden gesammelt hatten. Probehalber roch sie an den Steinen, aber sie hatte den Eindruck, davon würde sie eher krank werden, als dass sie ihren Durst daran stillen könnte. Zwischendurch dämmerte sie in einen immer schwerer werdenden Halbschlaf. Sie fürchtete schon fast nicht mehr, entdeckt zu werden. Es war noch ein paarmal vorgekommen, dass die ersten zehn, zwanzig Meter des Tunnels ausgeleuchtet wurden, zweimal kroch jemand ein Stück zu ihr hinein, so dass ihr die Silhouetten den Blick nach draußen verhingen und es noch dunkler war als zuvor, aber keiner aus der Rettungsmannschaft hatte seine Augen so an die Dunkelheit gewöhnt wie Judith. Beim ersten Mal wäre sie fast in Panik geraten, beim zweiten Mal war es nur noch aufregend. Sie musste sich bloß konzentrieren, schon wurde sie ein Teil der Leere, die sie umgab.
Als ihr klar wurde, dass sie so bald nicht ungesehen durch das Loch wieder nach draußen konnte, beschloss Judith eine Expedition ins Tunnelinnere zu machen, in der Hoffnung, dass der Schacht sie nicht geradewegs in die Arme anderer Patrouillen führen würde. Sie versuchte, sich die Landschaft wieder ins Gedächtnis zu rufen und sich vorzustellen, wohin der Weg führen, wo er enden könnte, aber es gelang ihr nicht, es konnte auf tausend Arten und in alle Richtungen weitergehen, nur nicht in die, aus der sie gekommen war. Sie zog den Rucksack auf und kroch hinab. Es wurde immer kälter, die Luft immer schlechter. Sie drehte sich alle paar Meter um und schaute in die Richtung, in der der Eingang lag, es half allerdings nichts, plötzlich war er weg. Sie hörte es tropfen und trappeln, als wäre der Tunnel selbst zum Leben erwacht. Die eine Hand tastete sich am moosigen Boden entlang, die andere streckte Judith in mutiger Zuversicht immer wieder voraus und unterdrückte den Impuls, etwas in die Leere zu rufen, ihren Namen oder einfach irgendetwas, um ihr Echo zu hören oder ein paar Tiere aufzuschrecken, die hier unten schon auf sie warteten, die Augen über Jahrhunderte an die Dunkelheit gewöhnt. Sie kroch und kroch. Wahrscheinlich gab es einige Kurven auf dem Weg, vielleicht musste sie auch ein Stück bergan zurücklegen, aber es ließ sich nicht mit Sicherheit sagen. Zuerst bemerkte sie überhaupt nicht, dass sich im Dunkeln ihre Hand abzeichnete und dass auch von den Wänden ein öliger Glanz zurückfiel. Als es ihr bewusst wurde, sah sie auch schon das andere Ende, die grüne Wiese dahinter, sorgsam durch ein Gitter in Planquadrate geteilt. Judith würde nicht umkehren, niemals, und einer flüchtigen Frau mit Werkzeugen im Rucksack stellte man sich ohnehin nicht einfach in den Weg. Bei näherem Hinsehen war das Gitter eine Gittertür mit einem Scharnier und etwas angerostet.
»Erle, Eibe, Douglastanne«, beschwor sie das Gitter. Das Echo ihrer Stimme trollte sich in die Höhle zurück. Mit einem fügsamen Knirschen ließ das Gitter sich öffnen und gewährte ihr den Weg nach draußen. Erstaunlich, wie schnell manche Gefängnisse einen gehen lassen. Sie kroch noch ein paar Meter, ehe ihr einfiel, dass sie sich jetzt wieder in die Länge strecken konnte. Sie lief in die offene Wiese hinein, dann ließ sie sich sinken, wärmte sich den Rücken am Boden und das Gesicht in der Sonne. Ihre Kleidung fühlte sich nicht mehr nur klamm an, sondern völlig durchnässt. Sie war ein Höhlentier geworden, eine Chimäre, der Rucksack ihr Schneckenhaus, Hose und T-Shirt ihr Exoskelett. Im Tageslicht kehrte sich die Metamorphose um und auf der Wiese wurde wieder ein Mensch aus ihr, welcher, wusste sie noch nicht. Nichts roch so gut wie diese Landschaft, die sich nicht darum scherte, dass sich ein paar hundert Meter weiter ein gewaltiger Riss in der Wirklichkeit offenbarte. Hier gab es niemanden, nur sie. Also gab es niemanden.
Wurmlöcher
Durch das Wasser glitten Schatten. Die Kois gaben sich keine Mühe, elegant oder auch bloß wendig auszusehen. Sie schwammen ohne Ziel in ihrem Teich umher; hin und wieder tauchte ein Fischmaul an der Oberfläche auf, schnappte nach etwas Unsichtbarem und verschwand wieder. Judith griff in die Tasche ihres Rocks und warf ihnen ein paar Würfel Brot ins Wasser. Sie konnte die Karpfen verstehen.
Die Fische scherten sich kaum um die Gaben. Eher zufällig verschwanden ein, zwei Brotstücke in den auf- und abtauchenden Mäulern. Die Schildkröte saß auf einem Stein, als wäre sie immer schon dort gewesen, reglos und felsenfarbig. Schwer zu sagen, ob sie lebte oder tot war, ob sie hellwach war oder schlief. Judith hatte schon Schildkröten aus Holz gesehen, die einen deutlich lebendigeren Eindruck gemacht hatten. Sie war die einzige Schildkröte hier. Früher waren sie zu dritt gewesen.
Die Parkanlage war klein, die Wege schlängelten und wanden sich jedoch, so dass man das Gefühl bekam, man hätte einen ausgewachsenen Spaziergang gemacht, kam man schließlich wieder beim Teehaus an. Man hatte außerdem von jeder Biegung des Hauptweges aus eine so andere Perspektive auf den Park, dass er Judith wie ein ganzes Universum mitten in Wien vorkam. Mal sah man die Häuser dahinter, mal nicht, mal streckten sich die Bäume und mal wirkten sie kaum so groß wie Judith selbst. Sogar die Farbe des Teichs veränderte sich, je nachdem, von wo aus man ihn betrachtete.
Von außen war das Teehaus kaum mehr als ein Schuppen und immer verschlossen. Die Fenster waren mit der Zeit halbblind geworden. Man konnte nur ein paar Sitzbänke im Inneren ausmachen und ansonsten karge Wände. Die Teezeremonien, die hier stattfanden, waren vermutlich heimliche Veranstaltungen, nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Judith ging oft hier spazieren, aber nie hatte sie von solch einer Séance gehört. Trotzdem mochte sie schon allein die Vorstellung, dass dieser unscheinbare Ort sich hin und wieder in etwas Besonderes verwandelte.
Der Wind plusterte ihren Rock auf. Sie hielt die Arme dicht am Körper, damit er nicht ganz nach oben flog. Judith ärgerte sich, dass sie es einfach nicht hinbekam, sich wettergemäß anzuziehen. Sie trug so gut wie nie Röcke, doch wenn, dann suchte sie sich den einzigen Sturmtag des gesamten Sommers dafür aus. Zum Abschluss ihrer Runde lief sie ans Ufer des Teichs und legte auch der Schildkröte ein Stück Brot auf ihren Stein. Die schwarzen Augen des Sauropsiden würdigten sie keines Blickes. Judith war nicht sicher, was verbotener war, den asphaltierten Weg zu verlassen oder die Tiere im Park zu füttern. Vielleicht war es gut, dass sie alle keinen Hunger hatten. Es war niemand in Sichtweite, offensichtlich hatten nicht einmal die Einwohner des Seniorenheims nebenan gerade Hofgang. Während Judith die Stufen zur Straße hinabstieg, aß sie die letzten mitgebrachten Brotstücke selbst auf, drehte ihre Rocktaschen auf links, schüttelte die Krumen heraus, stopfte sie wieder nach innen und grub ihre Hände hinein. Der Rock bauschte trotzdem.
Auf der anderen Straßenseite lag eine verwitterte Villa, die früher einmal ein Kinderheim gewesen war. Ein richtiges Horrorfilmkinderheim. Raben hüpften durch das wildwüchsige Gras im Garten. An Tagen wie heute passte all das zusammen, alles ergab einen Sinn. Die Patina, der graue Himmel, Stille und Sturm, Raben und Tauben, der japanische Garten und die Wiener Straßenzüge, ins Gesicht gewehte Haare, das Kreisen der Blätter im Wind, das leichte Unbehagen ohne erkennbaren Grund. Sie blickte nochmal zurück in Richtung Park, wenn man jedoch einmal durch das Tor hinausgegangen war, konnte man sich das Universum auf der anderen Seite bereits nicht mehr vorstellen. Plötzlich passte es zwischen zwei steinerne Pfeiler, kaum hüfthoch.
In letzter Zeit erwischte sie sich immer öfter dabei, wie sie Umwege machte. Statt gleich am gusseisernen Eingangstor der Villa in die Tram zu steigen, lief sie in eine der Seitenstraßen hinein, an der stillgelegten Insektizidfabrik vorbei. Dass sie das Haus überhaupt entdeckt hatte, verdankte sie nur ihrer neuen Leidenschaft, der Verzögerung des Heimwegs. Anfangs hatte es sie irritiert, wie großartig es sich anfühlte, allein zu sein. Mittlerweile hatte sie aufgegeben, sich schlecht zu fühlen, weil es ihr so gut ging mit sich selbst. Hier ging fast niemand spazieren, mit jedem Schritt wurde ihr der Flatterrock ein bisschen gleichgültiger, und je weniger sie daran dachte, desto harmloser wurde der Wind.
Wie immer ging sie durch einige ganz und gar uninteressante Straßen, die sie in ihrer Gleichförmigkeit mal beruhigten und mal deprimierten, bis sich ganz aus dem Nichts ihr Lieblingshaus auftat. Ein Paradiesvogelhaus. Die Außenfassade mit ihrer orientalischen Exzentrik und all ihrer zur Schau gestellten Seltsamkeit konnte nur ein Überbleibsel aus Zeiten sein, die mit dem Heute nichts zu tun hatten. So würde kein Mensch mehr bauen, nicht mal in Las Vegas. Es war zum Lachen. Der Architekt musste einen Heidenspaß gehabt haben. Das Lieblingshaus stand eingeklemmt zwischen Wohnhäusern, die bemüht unauffällig, fast ein wenig beschämt daneben aufgereiht waren, als wäre es ihre Aufgabe, dem ganzen Straßenzug eine bescheidene Normalität zurückzugeben, und als würden sie ihr Scheitern daran tapfer zu überspielen versuchen. Die Fabrik wurde mittlerweile anders als früher genutzt; Judith wusste nicht, wofür und von wem. Sie wirkte leer und durch ihre Leere noch eigenartiger.
Alles in allem verlängerte sich Judiths Heimweg dank des Schlenkers um eine gute halbe Stunde, vorausgesetzt, dass sie langsam ging und die Tram am anderen Ende der Straße weder sofort kam, noch eine nennenswerte Verspätung hatte. Langsam zu gehen fiel ihr nicht schwer. In letzter Zeit fühlte sie sich immer, als liefe sie gegen einen starken Wind an, und im Vergleich zu anderen sah sie vermutlich auch so aus. Lin bewegte sich so anders als sie, leicht und schnell, nie gehetzt, aber immer zügig. Sie lief, wie sie sprach; es war schwer, ihr zu folgen, doch wer sich die Mühe machte, wurde belohnt. Auch sonst wirkte sie immer, als hätte sie etwas Wichtiges vor, selbst dann, wenn sie einem ihre volle Aufmerksamkeit schenkte und ihre Konzentration eine kleine Falte in ihre Stirn grub, genau über der Nase, wo manchmal ihre Brille saß. Bei Judith selbst vermochte es die Unruhe in ihrem Kopf nie, ihre Beine mitzureißen, und ihre Gedanken schafften es nur mühsam und schwerfällig aus ihr heraus. Sie hatte ein paarmal erlebt, wie Leute das zu einem Kompliment verdrehten und ihre makellosen Sätze lobten. Dabei hatten sie auf dem langen Weg von ihrem Hirn bis zu ihrem Mund einfach viel Zeit, um Fehler abzuschütteln. Auch Judith lief, wie sie sprach. Es war fast ein Wunder, dass sie früher oder später doch an der Tramhaltestelle ankam. Heute ging sie noch ein Stück an den Schienen entlang, in die Richtung, aus der ihre Bahn kam, noch ein bisschen weiter weg von ihrer Wohnung, und noch ein bisschen.
»Sonntage machen mich depressiv«, sagte Lin. Sie saß am Küchentisch, das eine Bein angewinkelt, so dass sie das Kinn auf ihrem Knie ablegen konnte.
»Ich weiß. War das eigentlich immer schon so?«
»Wahrscheinlich. Zumindest lange genug, dass ich es gar nicht mehr mit Sicherheit sagen kann.«
»Ich finde Sonntage auch nicht besonders toll«, sagte Judith, obwohl sie dazu in Wahrheit keine Meinung hatte. Sie wollte Lin verstehen und ihr zeigen, dass sie verstanden wurde, wie sie so zusammengefaltet auf ihrem Stuhl saß und wartete, dass der Tag an ihr vorüberzog und sie ihn mit einem unspektakulären, ihrem großen und feinen Geist unangemessenen Fernsehfilm genauso würdelos beenden konnte, wie er es verdient hatte. Sie sah aus wie immer in ihren Jeans und dem dünnen Pullover, der auf die genau richtige Art zu groß war und ständig damit lockte, einen schnellen Blick auf ein Schlüsselbein oder eine bloße Schulter freizugeben, ohne diese Versprechen zu oft einzulösen.
Auf der Tischplatte lag eine Zeitung, die so großformatig war, dass man sie nie wieder ordentlich zusammensetzen konnte, hatte man einmal darin gelesen. Lin hatte es offensichtlich gar nicht erst versucht. Eine Doppelseite war auf den Boden geschwebt und halb unter den Herd gerutscht. Im Raum breitete sich ein Schweigen aus. Judith fragte sich, ob Lin es mitbekam. Sie hätte gern irgendetwas gesagt, vielleicht sogar erzählt, ihr wollte jedoch einfach nichts einfallen, das gegen diese Art von Stille eine Chance hätte. Sie setzte eine Kanne Tee auf und spülte Lins Lieblingstasse aus, gewissenhaft und langsam. Das Wasser ließ ihre Hände rot werden wie etwas Rohes, aber sie fühlte nicht, ob es zu heiß war. Lin verschwand immer mehr in sich selbst, in dieser ruhigen Konzentration, die einem das Gefühl gab, man dürfe sie jetzt nicht beim Denken unterbrechen. Judith musste sich Mühe geben, so etwas wie Freude in ihrem Gesicht zu lesen, als sie den Tee auf den Tisch stellte und ein Glas Honig dazu. Sie dachte an Berlin. Lin war mal zu ihr genauso gewesen wie zu ihren Freundinnen, hing an ihrem Arm, wenn sie spazieren gingen, und redete mit ihr auf eine Art, die jedes Gespräch in Gang hielt. Judith hingegen war zu Lin anfangs vollkommen anders gewesen als zu anderen Leuten. Und jetzt verhielt sie sich wie gewohnt, servierte im Stillen und wusste nichts mitzuteilen.
Es roch noch nach den aufgebackenen Croissants aus der Früh. Ihre Wohnung hatte, seit sie zusammengezogen waren, einen richtigen, beständigen Zuhausegeruch bekommen. Im Bad duftete es nach Seife und Creme, in Lins Zimmer nach sauberer Wäsche, alten Büchern und frisch bedrucktem Papier. Nur in Judiths Zimmer roch es nach nichts, oder jedenfalls nach nichts, das diesseits ihrer Wahrnehmungsschwelle lag. Lin würde behaupten, es röche nach Holz. Das mochte sein, nur roch Holz in Wirklichkeit nicht nach Holz, sondern nach Tanne, Buche oder Birke. Nach Kirschbaum oder Nussbaum, nach den ätherischen Ölen in den Hölzern und Harzen. Oliven- oder Leinöl, Bienenwachs oder Lasur. Und nichts davon hatte in ihrem Zimmer Spuren hinterlassen. Vielleicht hob sich alles, was sie je besessen oder hergestellt hatte, gegenseitig auf, vielleicht hatte sie durch Zufall Stück und Gegenstück gefunden, Positiv und Negativ. Judith zog die Zeitungsseite unter dem Herd hervor und setzte sich zu Lin. Ihr Blick wanderte über die Buchstaben, wollte allerdings nirgends bleiben, nicht einmal bei den Bildern. Lin saß eine Weile einfach nur da, dann nahm auch sie das Lesen wieder auf. Es sah glaubhafter aus als bei Judith selbst, dieses Zeitunglesen, Lin hatte offenkundig viel mehr Übung. Ohne Furcht schlug sie eine lange Reportage auf und versank darin, während Judiths Blick sich irgendwo im Muster der Gardinen verfing.
Der Esstisch war alt und schwer und hatte den Weg vom Schwarzwald bis in die Werkstatt in Wien auf den verworrensten Wegen zurückgelegt. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, ihn abzuschleifen und das Holz wieder herzurichten. Judith hatte nach Feierabend daran gearbeitet, manchmal auch in der Früh, wenn sie noch allein in der Werkstatt war. Kurz bevor jemand von den anderen zur Arbeit kam, hatte sie ihn mit einem Leintuch abgedeckt, das weiß gewesen war, ehe es den Staub und die Gerüche der Werkstatt so sehr angenommen hatte, dass alles darunter automatisch unsichtbar wurde. Nur Milo hatte sie den Tisch gezeigt. Er hatte genickt, anerkennend, und ihr gezeigt, wie die Platte noch ein bisschen gerader wurde und noch ein wenig glatter. Judith hatte die Wurmlöcher verschlossen und Kratzer ausgebessert, geölt und nochmal geölt, bis der Tisch alt und zugleich neu aussah. Sie erinnerte sich an den Moment, als sie ihn für fertig erklären musste, weil es beim besten Willen nichts mehr gab, das noch poliert oder geschliffen werden musste; sie hätte sich freuen müssen, als der Tisch in ihrer Küche stand, ein paar Tage vor Lins Ankunft mit dem Möbelwagen. Zumal er gut geworden war, richtig gut, dreimal besser als ihr Gesellenstück. Aber sie vermisste den unfertigen Tisch, das wurmstichige Holz, das so viele Jahre lang den Alltag fremder Menschen eingeatmet und aufgesogen hatte. Es hatten mit Sicherheit einige Familien an dem Tisch gegessen, womöglich Bauern, die es nicht allzu schlecht erwischt hatten, mit ihren Kindern und Katzen und den Kindern von nebenan. Oder ernste, verschlossene Menschen, die ihre Mahlzeiten, ohne vom Teller aufzusehen, zu sich nahmen und so viele Bäume vor der Haustür hatten, dass sie kein Holz mehr riechen konnten. Manche beteten vor dem Essen, andere stritten, schwiegen oder erzählten einander von ihren Tagen. Sie aßen Suppen und Sonntagsbraten, Weihnachtsessen und Geburtstagskuchen. Mittlerweile war der Tisch ganz und gar Teil von Judiths und Lins Wohnung geworden, er fügte sich in die Küche, als habe er nie anderswo gestanden, und er mischte sich nicht ein, wenn es so still wurde wie jetzt.