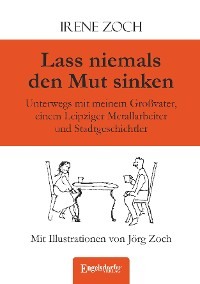Buch lesen: "Lass niemals den Mut sinken"
Irene Zoch
LASS NIEMALS
DEN MUT SINKEN
Unterwegs mit meinem Großvater,
einem Leipziger Metallarbeiter und Stadtgeschichtler
Mit Illustrationen von Jörg Zoch
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2016
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Stadtspaziergang
Schwere Kindheit
Lehrjahre in Leipzig
Als Metallarbeiter in Leipziger Firmen
Als Mechaniker in der Konsumgenossenschaft Leipzig-Plagwitz
Lernen und Unterhaltung im Arbeiterbildungsinstitut Leipzig – Begegnung mit Gustav Hennig
Als Soldat in Frankreich
Zurück aus dem Ersten Weltkrieg
‚Karriere‘ als Humorist und Kabarettist
Die Jahre nach 1933
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei
Treffen am Waldplatz
Als Mitarbeiter des Stadtgeschichtlichen Museums
Verabschiedung in den Ruhestand
Epilog
Anhang
PROLOG
Bei den Recherchen zu meinem Büchlein „Ma chère Frieda“, mit Illustrationen von Jörg Zoch, bin ich immer wieder auf Erinnerungen an meinen Großvater Alfred Mohr gestoßen. Er war, weil mein Vater aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekommen ist, eine wichtige Bezugsperson für mich. Oft habe ich über unser Verhältnis nachgedacht. Darüber, was wir gemeinsam unternommen haben, worüber wir uns unterhalten und auch mal gestritten haben, und was mir mein Großvater auf den Lebensweg mitgegeben hat. Ich schaute mir in letzter Zeit auch eingehender als früher die von meinem Großvater hinterlassenen Fotos, Postkarten, Urkunden, Zeugnisse und das Vortragsmaterial für seine Auftritte als Humorist und Kabarettist an und las zum wiederholten Male seine kurzen schriftlichen „Erinnerungen eines Leipziger Arbeiters“.
Als sich dabei Fragen ergaben, die ich nicht beantworten konnte, habe ich mich an Archive gewandt und einschlägige Literatur gelesen. Zu guter Letzt hat mich mein Cousin Ludwig Kühnl bei Fragen zum Ersten Weltkrieg unterstützt.
Aus all dem sind schließlich die ‚Gespräche mit meinem Großvater‘ zustande gekommen. Ich habe lange überlegt, ob ich sie öffentlich machen sollte. Da ich aber der Meinung bin, dass sie einen starken Bezug zur Gegenwart haben, habe ich mich entschieden, ein Büchlein daraus zu machen.
Die aufgeschriebene Lebensgeschichte ist wahr. Ich leugne jedoch nicht, dass ich auch an manchen Stellen meine Fantasie habe spielen lassen – immer im Kopf, der Wahrheit nahezukommen.
IRENE ZOCH, Juni 2016

Mein Großvater Alfred Mohr mit seiner Frau Margarete (1904)
Stadtspaziergang
An einem sonnigen Märztag des Jahres 1954 bahnen sich mein Großvater und ich – ein vierzehnjähriges Mädchen – den Weg durch die Leipziger Innenstadt. Es ist Frühjahrsmesse. Viele Leipziger sind ins Zentrum gekommen, um ein wenig den Duft der großen weiten Welt zu schnuppern. Aus den Handelshäusern fluten Besucherströme hinein und heraus. In den Cafés und Restaurants findet man kaum einen freien Platz. Großvater und ich kämpfen uns bis zur Hainstraße Nr. 1 am Alten Markt durch. Hier bleibt Großvater stehen. „Lies’ doch mal, was über dem Eingangsportal steht.“ „Barthels Hof“, entziffere ich. „Hier hat man während der Messen, auf denen man früher nur mit Waren gehandelt hat und nicht mit Warenmustern wie heute, Schutz vor Wind und Wetter gefunden“, erzählt mir Großvater. Er ermuntert mich, mit ihm durch eine überbaute Gasse zu gehen, die in einen größeren Platz mündet, der von vierstöckigen Häusern mit hohen Dächern umgeben ist.
„Schau mal, fällt dir da oben an den Häusern etwas Besonderes auf?“
„Meinst du die Kranbalken?“
„Ja, das sind Lastenaufzüge, mit denen die Handelswaren auf die Böden hinaufgezogen worden sind. Und hier im Erdgeschoss waren Kaufkammern, Ställe und Wirtschaftsräume. Im Obergeschoss gab es prachtvolle Wohnungen, Kontore und auch schöne Festsäle. Während der Messe konnte man hier Verkäufern, Käufern, Geldwechslern, Schreibern, neugierigen und feiernden Leuten begegnen. Und da drüben in ‚Barthels Weinschänke‘ hat man abends die gelungenen Messegeschäfte begossen. Du musst dir vorstellen, der Hof war so etwas wie eine Stadt in der Stadt.“
„Großvater, ich fühle mich hier wie in einer Burg.“
„Na, da hast du gar nicht so Unrecht. Goethe, der als Student in Leipzig war, hat davon gesprochen, dass die sechzehn Durchgangshöfe, die es in Leipzig gab, großen Burgen ähneln würden. Aber nun dreh’ dich mal um zur Marktseite. Da siehst du doch den zweistöckigen Erker mit einer goldenen Schlange und einem aufgeschlagenen versteinerten Buch. Die Inschriften kannst du nicht verstehen. Sie sind auf lateinisch, griechisch und hebräisch geschrieben. Eine davon bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament. Sie berichtet von der Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste Sinai ins Gelobte Land Kanaan, das auf dem Weg dorthin den Mut verlor, ungeduldig wurde und nörgelte: ,Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Wären wir doch dort gestorben!‘ Der Herr schickte Moses daraufhin feurige Schlangen und befahl ihm, eine kupferne Schlange anzufertigen und diese auf eine Signalstange zu hängen. Jeder, der gebissen und zur Schlange aufschauen würde, sollte geheilt werden und den Weg in das Land der Freiheit fortsetzen können. Und weißt du was, der Mann, der dieses Gebäude, vor dem wir stehen, bauen ließ, glaubte fest daran, dass die goldene Schlange, also der göttliche Beistand, auch bei wirtschaftlichen Angelegenheiten nützlich sein könnte. Deshalb ließ er die goldene Schlange an dem Gebäude anbringen.“

Die Goldene Schlange in Barthels Hof
„Großvater, sei nicht böse, aber du hast mir schon so viel erzählt, dass nichts mehr in meinen Kopf reinpasst. Können wir bitte weitergehen?“
„Selbstverständlich. Ich schlage vor, wir versuchen einmal, im Café ,Corso‘ zwei Plätze zu bekommen.“
Und so machen wir uns auf den Weg dorthin. Das Café, ausgestattet im Wiener Stil mit kleinen Marmortischen, Ornamenttapete, Wandleuchten und Spiegeln, ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Ein paar Damen sitzen beim Kaffeeklatsch, ein Herr mit grau meliertem Haar blättert in einer Tageszeitung, die in einen Lesestock geklemmt ist. Ein junges Paar schaut sich verliebt in die Augen und hat die Welt um sich herum vergessen. Studenten schauen in ihre Notizen oder lesen Bücher. Großvater und ich finden noch in einer Ecke zwei Plätze. In diesem Moment kann ich nicht ahnen, dass ich Jahre später als Studentin im ‚Corso‘ oft in den Vorlesungspausen mit meinen Kommilitonen zusammensitzen würde. Großvater bestellt zwei Tassen ‚Bliemchenkaffee‘ und zwei ‚Leipziger Lerchen‘.
„Hast du schon mal eine ‚Leipziger Lerche‘ gegessen?“, fragt er mich.
„Nein, noch nie. Was ist das?“
„Ein Gebäck, sein Name erinnert daran, dass die Leipziger früher, vor allem an Festtagen, Lerchen gegessen und die Stadtväter deshalb die Jagd auf diese Vögelchen verboten hatten. Da dachten sich Leipziger Wirte ein mit Marzipan gefülltes Gebäck aus, das bis heute den Namen ‚Leipziger Lerche‘ trägt.“
Nachdem Großvater bezahlt hat, verlassen wir das ‚Corso‘ und laufen hinüber zur Mädler-Passage. Viele Passanten eilen an den Ladengeschäften vorbei, einige schauen sich die überlebensgroßen Figuren vor dem Eingang zu Auerbachs Keller an: Mephisto und Faust auf der einen und die von Mephisto verzauberten Studenten auf der anderen Seite. Großvater führt mich die Treppe zum historischen Gasthaus hinunter. Er läuft mit mir durch den ‚Großen Keller‘ und die ‚Historischen Weinstuben‘ bis zum ‚Fasskeller‘, der durch Goethes ‚Faust‘ berühmt geworden ist. Ich bin sehr beeindruckt von dem aus Holz geschnitzten Hängeleuchter unter dem Tonnengewölbe, der Faust auf einem Fass reitend zeigt. Das bemerkt mein Großvater und erklärt mir deshalb, dass der Schwarzkünstler Dr. Faustus zur Ostermesse 1525 in den Auerbachs Hof gekommen und in den Weinkeller hinabgestiegen sei. Hier habe er sich bei Gesang, Wein, Geigen-, Flöten- und Lautenspiel sehr wohlgefühlt. Zusammen mit seinem dienstbaren Geist Mephisto habe er sich an die Tafel zu den Zechgesellen gesetzt und denen über seine Reisen in ferne Länder erzählt. Da seien in den Keller einige ‚Schröter‘ hereingeplatzt, die ein Weinfass nach oben schroten wollten. Als ihnen das nicht gelang, soll Faust über sie gespottet haben. Da habe der Wirt angeboten, demjenigen das Fass zu überlassen, der es aus dem Keller bringen würde. Daraufhin soll sich Faust auf das Fass wie auf ein Pferd geschwungen haben und nach oben geritten sein. Voraus sei ein Hündchen gelaufen, das niemand anderer war als Mephisto, der seine Verwandlungskünste genutzt hatte.

Faust und Mephisto vor Auerbachs Keller
„Davon werde ich heute Nacht träumen“, sage ich zu Großvater, denn in meiner Fantasie wird der ‚Fassritt‘ lebendig. Ich glaube sogar, das Ah und Oh der Gäste von damals zu hören, die dem Wein schon ordentlich zugesprochen hatten, als Faust auf dem Fass aus dem Keller ritt. Doch schon werde ich in die Wirklichkeit zurückgerufen.
„Dort drüben ist das steinerne Hauszeichen des Grundstücks“, macht mich Großvater auf den Bacchusknaben mit dem Krug und dem Fass aufmerksam. Ich kann die Zahl 1530 erkennen.
Noch ganz gebannt von dem Erlebten laufe ich mit Großvater durch das Gasthaus zurück nach oben in die Passage, von dort zum ‚Alten Markt‘, weiter zur Thomaskirche und dann in Richtung Schauspielhaus. Kurz bevor wir gegenüber der Thomaskirche in die Gottschedstraße einbiegen, bleibt Großvater stehen.
„Weißt du, dass früher hier an dieser Stelle der Pleißemühlgraben war, auf dem man Boot fahren und Schlittschuhlaufen konnte? Anfang der 50er Jahre hat man ihn zugeschüttet.“
„Wieso denn das?“
„Das Wasser im Mühlgraben ist seit den 1940er Jahren durch das Abwasser der petrolchemischen Industrie im Süden von Leipzig sehr stark belastet worden. Der Geruch war durch die phenolhaltigen Schaumkronen fast unerträglich. Übrigens sind der Mühlgraben der Pleiße und der Mühlgraben der Weißen Elster vor Jahrhunderten angelegt worden, um mehrere Mühlen betreiben zu können: die Barfußmühle, die Thomasmühle und die Nonnenmühle am Pleißemühlgraben und die Angermühle am Elstermühlgraben. Die Namen der Mühlen kannst du dir ganz leicht merken: ‚Thomas ging mit seiner Nonne barfuß über’n Anger weg.‘
Mehrere Male wiederhole ich den Vers. Bis heute habe ich ihn nicht vergessen.

Bacchusknabe mit Krug
So wie an diesem Tag war ich oft und gern mit meinem Großvater auf Erkundungen in der Stadt unterwegs. Aber das war bei Weitem nicht das einzige, wofür ich ihm noch heute dankbar bin. Großvater hat sich auch immer Zeit genommen, mit mir Dinge zu besprechen, die mich als junges Mädchen interessiert haben. Dabei kam ich oft aus dem Staunen nicht heraus, was für ein Wissen er besaß und wie lebensklug er war. Als ich meinen Großvater eines Tages daraufhin ansprach, maß er dem keine Bedeutung bei. Aber dann versprach er mir, in den kommenden Wochen immer wieder einmal etwas aus seinem Leben zu erzählen und darüber, wie er sich ein bestimmtes Wissen angeeignet hat. Er wusste, dass er in mir eine gute Zuhörerin haben würde.
Schwere Kindheit
An einem warmen Frühlingstag sitzen Großvater und ich auf einer Bank unter der Linde hinter dem Haus, in dem sich meine Großeltern, meine Mutter und ich seit 1946 eine Wohnung teilen. Ich besuche die 9. Klasse der Erweiterten Oberschule und bin vor etwa zwei Stunden nach Hause gekommen. Mein Großvater – 76 Jahre alt, noch volles schwarzes Haar und Menjou-Bärtchen – schaut mich aus seinen gutmütigen braunen Augen an und fragt, ob er heute beginnen solle, sein Versprechen einzulösen, mir einiges aus seinem Leben zu erzählen. Als ich ihm sage, dass ich schon lange darauf warte und sehr gespannt bin, beginnt er zu erzählen:
„Du wolltest neulich wissen, warum ich mich in unserer Stadt recht gut auskenne. Da muss ich mit meiner Kindheit anfangen. Ich wurde im Februar 1879 in Deutrichs Hof geboren. Das war ein Durchgangshof mitten in der Innenstadt von Leipzig, der sich zwischen der Reichsstraße und der Nikolaistraße erstreckte. Dort verbrachte ich die ersten Jahre meiner Kindheit. Als ich sechs Jahre alt war, starb mein Vater mit nur neununddreißig Jahren. Von da an habe ich erfahren müssen, wie hart das Leben sein kann. Meine Mutter kam über den Tod ihres Mannes nicht hinweg, sie wurde krank und hatte Mühe, sich um meine Schwester und mich zu kümmern. Ein Glück, dass unsere Tante Klara oft zu uns kam und uns zur Seite stand. Wir hatten damals sehr wenig Geld, und so musste ich zu unserem Lebensunterhalt beitragen. Ich machte kleinere Besorgungen für ältere Leute und trug Reklamezettel aus. Dafür bekam ich wenige Pfennige. Mit zehn Jahren fand ich Arbeit im Delikatessengeschäft Wernicke in der Nikolaistraße. Dort erhielt ich außer einem Lohn von 1,50 Mark einmal in der Woche ein besonders gutes Essen. Jeden Tag musste ich aber bis zum Ladenschluss um 22.00 Uhr durchhalten. Mittags trug ich für die Eltern des Solotänzers Striegel Essen aus. Das war für mich ein Glücksumstand, denn das Ehepaar machte mich darauf aufmerksam, dass das ‚Neue Theater‘ – du kennst es nicht mehr, es ist im Krieg den Bomben zum Opfer gefallen - für das Ballett ‚Meißner Porzellan‘ Kinderdarsteller sucht. Das interessiert mich, war mein erster Gedanke, und außerdem kann ich ein paar Pfennige verdienen. Ich begab mich deshalb schon bald auf den Weg zum Theater und nahm nach kurzer Zeit an ersten Proben teil, die vom Ballettmeister Jean Golinelli und den Solotänzerinnen Rosa Viebig und Agnes Donges geleitet wurden. Für die Proben, die meistens sonntags stattfanden, bekam ich kein Geld. Dafür gab es für jede Aufführung 25 Pfennige, und ich war 150 Mal dabei. Außerdem habe ich noch in Weihnachtsmärchen mitgespielt. Auch dafür bekam ich eine Gage von 25 Pfennigen pro Aufführung. Ich erinnere mich, dass eines der Märchen ‚Der Kurier des Zaren‘ hieß.“
„Großvater, du hast Theater gespielt und zur gleichen Zeit auch noch im Delikatessengeschäft gearbeitet. Und zur Schule musstest du doch auch gehen? Wie hast du denn das geschafft?“
„Na ja, als ich mit dem Theaterspielen begann, habe ich meine Stelle bei Wernicke aufgegeben und bin zur Firma Thietmeyer gegangen. Da war schon 19.00 Uhr Ladenschluss, und ich konnte um 19.30 Uhr im Theater sein. Hinzu kam, dass ich bei Thietmeyer sogar zwei Mark in der Woche verdiente. Aber die Frage, wie ich Theater, Arbeit und Schule unter einen Hut gebracht habe, ist schon berechtigt. Es war sehr hart, es hieß, die Zeit gut einzuteilen. Wenn ich damals in der Schule abgerutscht wäre, dann hätte ich nicht mehr Theater spielen dürfen, da hätte die Schule nicht mitgemacht. Ohne ihre Genehmigung ging nichts. Und wenn die Lehrer gewusst hätten, unter welchen Bedingungen ich meine Schulaufgaben erledigte, zum Beispiel auf den Steinstufen von Zscharmanns Haus am Blücherplatz, dann hätten sie mich im Handumdrehen ins Waisenhaus gesteckt. Davor aber hatte ich große Angst. Trotzdem bin ich eines Tages zusammen mit meiner Schwester dort gelandet.“
„Wieso denn das?“
„Lass es mich der Reihe nach erzählen. Ich habe damals die Ratsfreischule am Rosental in der Zöllnerstraße 3 besucht. Das war eine Schule der Stadt Leipzig, in der die Kinder unterrichtet wurden, deren Eltern kein Schulgeld aufbringen konnten. Die Ratsfreischule, eine Volksschule, war schulgeldfrei. Kaum zu glauben, dass sie einen so guten Ruf hatte. Der Unterricht und die Disziplin waren sogar besser als in den privaten Schulen.“
„Dann hast du dich in dieser Schule wohlgefühlt?“
„Ja, auf jeden Fall. Vor allem war der Schuldirektor Dr. Helm wie ein Vater zu uns. Ihm wird es sehr leid getan haben, als er mich und meine Schwester eines Tages zu sich rufen musste. Er teilte uns mit, ein Herr vom Rate, von der Stadt, sei wegen uns bei ihm gewesen und er wolle am nächsten Tag wiederkommen. Da ahnte ich nichts Gutes. Nach dem Gespräch bei Dr. Helm begab ich mich mit meiner Schwester auf den Heimweg. Wir wohnten jetzt bei Tante Klara im Gerichtsweg. Als wir bei ihr eintrafen, war sie gerade dabei, das Mittagessen auf den Tisch zu bringen. Da klingelte es an der Tür. Du kannst dir nicht vorstellen, wer da zu Besuch kam.“
„Nein, wer kam denn da?“
„Kein anderer als der Herr vom Rat, übelgelaunt. Er hatte den weiten Weg vom Rosental bis zu uns nach Reudnitz bei großer Hitze nehmen müssen. Wir durften keinen Bissen essen, sondern mussten sofort mit ihm zurück in die Stadt laufen. Das Ziel war die Münzgasse.“
„Wo ist die denn? Und warum hat er euch dorthin gebracht?“
„Die Münzgasse geht vom Peterssteinweg ab. Den kennst du doch?“
„Der ist in der Nähe vom Leuschnerplatz?“
„Ja, richtig. Und nun will ich dir sagen, was uns in der Münzgasse erwartete: Das Waisenhaus. Gott sei Dank existierte zu dieser Zeit das ehemalige ‚Zucht-, Arbeits- und Waisenhaus‘ nicht mehr.
„Aber das war ja trotzdem schlimm.“
„So sah es anfangs auch aus. Der Waisenhausvater, ein alter ehemaliger Feldwebel begrüßte mich mit den Worten: ,Du bist wohl auch so eine Akazie wie der dort‘ und wies dabei auf einen am Fenster stehenden Jungen. Du kannst dir gut vorstellen, dass ich sehr erschrocken und eingeschüchtert war. Als ich aber dann beim Abendbrot die Waisenhausmutter Schwabe kennenlernte, da ging es mir schon etwas besser. Sie war sehr gut zu mir, und wie ich später erleben konnte, war sie zu allen ihr anvertrauten Kindern wie eine gute Mutter. Dann gab es noch den Waisenhausdirektor mit seiner Familie. Auch die waren für uns gute Freunde. Ich muss schon sagen, wir waren hier in der Münzgasse sehr gut untergebracht, hatten unsere Ordnung und wurden liebevoll behandelt. Aber mit dem Theaterspielen war es von nun an vorbei. Die Bretter, die die Welt bedeuten, sollte ich erst viel später wieder betreten.“
„Wie lange, Großvater, warst du eigentlich im Waisenhaus?“
„Mit zwölf Jahren bin ich dorthin gekommen und mit vierzehn Jahren konnte ich es wieder verlassen. Ich war bis zur Konfirmation zu Palmarum 1893 dort. Das Beste, was mir im Waisenhaus passieren konnte, war, dass sich ein Erzieher, der Hilfsgeistliche Scheibe und späterer Pfarrer der Reformierten Kirche Leipzig, ganz besonders liebevoll um mich kümmerte. Dem habe ich wirklich sehr viel zu verdanken. Jeden Sonntag hat er mit mir einen Spaziergang unternommen, mir jeden Winkel der Stadt gezeigt, viel über Leipzig erzählt und mit mir über Gott und die Welt gesprochen. So verlief mein Leben vom 12. bis zum 14. Lebensjahr in ruhigen Bahnen. Mit 14 Jahren schloss ich die Schule ab und sollte eine Lehrstelle als Schmied in Klosterbuch annehmen. Das Schurzleder war schon bei Rohr am Obstmarkt angemessen worden. Aber ich hatte überhaupt keine Lust, Schmied zu werden. Viel lieber wollte ich mich zum Mechaniker ausbilden lassen, denn ich bastelte für mein Leben gern. Als ich darüber mit dem Waisenhausdirektor sprach, warnte er mich, dass ich dann keinerlei Unterstützung bekäme. Das war mir egal. Ich habe ihm versichert, meine Großmutter würde für mich sorgen, was eine Notlüge war. Aber, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“
„Da bist du ja ganz schön mutig gewesen.“
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.