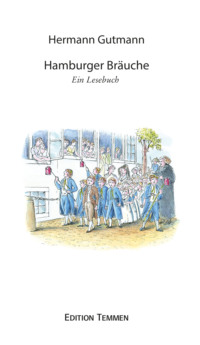Buch lesen: "Hamburger Bräuche"
Hermann Gutmann
Hamburger Bräuche
oder
Von tranigen Alsterschwänen, kräftigen Brauern und kostspieligen Vergnügen
Umschlagillustration von Peter Fischer
1. Auflage 2010
© 2010 Edition Temmen e.K.
Hohenlohestr. 21 – 28209 Bremen
Tel. 0421-34843-0 – Fax 0421-348094
info@edition-temmen.de
www.edition-temmen.de
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Edition Temmen
Ebook ISBN 978-3-8378-8050-2
Print ISBN 978-3-8378-1104-9
Inhalt
Von Ansgar und anderen Quiddjes
Die Schwäne auf der Alster schmecken tranig, aber sie sind Garanten für die Unabhängigkeit der Stadt
Die Hamburger wollen keine Steigbügelhalter sein – und Kaiser Wilhelm war beleidigt
Wie Graf Otto nicht nach Hause finden konnte und St. Pauli zu Hamburg kam
Weinkenner unter sich und der Beigeschmack eines Rheingauers
Stühlerücken am Petriabend und was es mit der Bursprake auf sich hat
Mattheis bricht das Eis – eine alte Bauernregel gilt auch für das Matthiae-Mahl
Herr Dr. Schaffshausen wurde mit seiner Stimme zum Bürgermeister gewählt
Hamburg högte sich und feierte nahrhafte Feste
De Hambörger sehn dörch de Finger
Freundschaft, Eintracht und Gemeinsinn – der Hamburger Blücherklub
Essen mit den Fingern
Waisengrün – ein Volksfest zugunsten der Ärmsten
Hummel! Hummel! Erkennungsruf, Autokennzeichen und Johann Wilhelm Bentz
Erst kommt das Essen und dann die Kunst
Der Spieltrieb der Hanseaten. Ein Posten im Haushaltsplan
Die Bedienten rümpften die Nase, doch die Etatsrätin Donner jubelte
Das Honorar muss stimmen
Eine Frage des Eigentums
Der Adventskranz ist ein Hamburger Kind
Geht leider nicht
»He lücht« spinnt gern Seemannsgarn
Papst Zacharias zeigte sich besorgt
Wer geweihte Ostereier besitzt, kann aus der Krankenkasse austreten
Im Revolutionsjahr 1848 gingen die Lämmermarktsbuden in Flammen auf
Wie aus dem Christmarkt am Dom der »Dom« wurde
Winterfreuden in Hamburg
Wer sollte einem Hamburger Senator einen Orden verleihen?
Mit Weisheit und Verstand
Quiddjes bleiben lebenslang Quiddjes, manchmal aber gehören sie zu den besten Hamburgern
To Huus
Das Hammonia-Lied
Literatur
Der Autor
Von Ansgar und anderen Quiddjes
Aus welchem Blickwinkel auch immer die Geschichte der Freien und Hansestadt Hamburg betrachtet wird – eines steht fest: Die ersten Hamburger kamen von außerhalb. Es waren also Fremde, Quiddjes.
Das fing schon mit dem »Alten Schweden« an.
Der »Alte Schwede« ist der Findling in Övelgönne, der Stein am Elbufer, der in der Eiszeit vor 14.000 Jahren nach Hamburg gekommen ist und den die Hamburger mit liebevollem Spaß als »ältesten Ham-burger« bezeichnen. Aber ein Quiddje ist er doch.
Dieses Spiel setzte sich fort mit dem Römer Nero Claudius Drusus, 38 bis 9 vor Christi.
Er soll, so weiß es die Geschichte, bis an die Elbe vorgestoßen sein. Dort habe er – so wird erzählt – auf einer Anhöhe dem römischen Sonnengott Sol einen Tempel errichtet. Die Anhöhe habe daraufhin den Namen Solberg erhalten. Daraus ist der Süllberg geworden.
Nun soll nicht behauptet werden, dass sich der Römer Drusus in Hamburg niedergelassen und als Quiddje sein Leben beschlossen habe. Er ist nicht lange an der Elbe geblieben. Vermutlich behagte ihm die etwas spröde Gastfreundschaft der dort lebenden Germanen nicht.
Er trat, ob gewollt oder unter unsanftem Druck, den Rückmarsch an. Dabei hatte er es wohl etwas eilig. Sein Pferd vertüdelte sich. Drusus fiel runter und ging mit dem Tode ab. Die Römer verliehen ihm daraufhin den Siegertitel Germanicus.
Auch sollen die heidnischen Sachsen die Elbufer unsicher gemacht haben. Und just dort, wo Drusus seinem Sonnengott Sol einen Tempel gebaut hatte, auf dem Süllberg, verehrten die heidnischen Sachsen ihren Donnergott Thor, der nach altem Brauch einen Hammer in der Hand hielt.
Unangenehm waren die Wenden, die nicht nur an Alster und Elbe ihre Duftmarken hinterließen. Sie brachten auch ihren Sonnengott Wedel mit. Noch heute gibt es den Ort Wedel – allerdings im schleswig-holsteinischen Kreis Pinneberg. Die Wedeler Schiffsbegrüßungsanlage »Willkomm Höft« wurde erst im Jahre 1952 eingerichtet.
Die ersten Siedler, die sich um 700 auf einer 15 Me-ter hohen Geestzunge, also in schwindelnder Höhe, zwischen Bille und Alster niederließen, gehörten den Nordalbingiern an. Es waren also Sachsen, die nördlich der Niederelbe wohnten.
Ob die kleine, hochgelegene Siedlung, die nach Expertenmeinung ein Dorf mit drei bis fünf Bauernhöfen war, damals schon Hamburg hieß, ruht im Dunkel der Vergangenheit.
Eher trug die Siedlung überhaupt keinen Namen.
Die Siedler trieben Ackerbau und Viehzucht und lebten ohne Kalender in den Tag hinein. Gegen Ende des Jahrhunderts jedoch wurden sie in ihrer Ruhe empfindlich gestört. Denn die fränkischen Soldaten unter Karl dem Großen hatten die Elbe überschritten und machten sich daran, das Land zu unterwerfen.
Dazu gehörte, dass sie Festungsanlagen bauten, Zwingburgen sozusagen. Auf diese Weise soll die erste Hammaburg entstanden sein: eine knallharte Wehr gegen die Nordalbingier, die mit den Franken nichts zu tun haben wollten, und ein Schutz für die fränkischen Soldaten, in deren Gefolge sich dialektisch tummelnde christliche Brüder befanden.
Der Krieg der Franken gegen die Nordalbingier wurde allerdings wegen mangelnder Konferenzsäle nicht in Hamburg beendet.
Fränkische und dänische Delegationen trafen sich an der Eider. Und weil der neue König Hemming von Dänemark ein friedfertiger Mensch war, hatte er nichts dagegen, dass die Franken, die nun schon mal nördlich der Elbe Fuß gefasst hatten, dort auch blieben.
Das Land Nordalbingia (Nordelbingen) zerfiel in vier Gaue, von denen Karl der Große Holstein, Stormarn und Dithmarschen seinem Reich einverleibte. Den vierten östlichen Gau Wagrien überließ er den slawischen beziehungsweise wendischen Obotriten.
Nach Abschluss eines entsprechenden Vertrages wurde der vom Bischof von Trier geweihte Priester Heridac im Jahre 811 von Karl dem Großen als Mis-sionar in die Hammaburg entsandt.
Heridac, in dessen Lebensplanung die Hammaburg eigentlich gar keinen Platz hatte, war also der erste nachweisliche Quiddje, der sich in Hamburg niederließ, und das gleich an leitender Stelle.
Die Hamburger Luft scheint ihm dann auch tatsächlich nicht gut bekommen zu sein. Im Jahre 812 legte er sich ins Bett und stand nicht wieder auf.
Etwa gleichzeitig bauten die Franken eine neue Hammaburg, die für sie besseren Schutz bot. Im Bereich der Burg, am Nordufer des Reichenstraßen-fleets, das auch als Hafen diente, entwickelte sich eine Kaufmanns- und Handwerkersiedlung. Die spätere Reichenstraße am Reichenstraßenfleet erhielt ihren Namen nach den Reichen, die sich dort niedergelassen hatten und dort auch ihren Geschäften nachgingen. Es gab übrigens in Hamburg – wie überall – soziale Unterschiede. Eine Armenstraße allerdings gab es nicht,
Im Jahre 831 quartierte sich der damals 30-jährige Missionar Ansgar (801 – 865) in Hamburg ein. Er war, wie Heridac, ein Quiddje. Aber er war es ohne Widerworte.
Geboren wurde Ansgar in der Picardie in Frank-reich, möglicherweise als Spross einer sächsischen Kolonistenfamilie aus Flandern.
Er soll nicht weit von der Hermannstraße gewohnt haben, was Sie aber gleich wieder vergessen können. Denn die Hermannstraße gab es damals noch nicht.
Immerhin wurde Ansgar nicht lange nach seiner Übersiedlung an die Elbe mit dem Titel Erzbischof von Hamburg belohnt, was aber wirklich nur ein blanker Titel war. Mit größeren finanziellen Einnahmen konnte Ansgar nicht rechnen.
Er tat es auch nicht. Denn Gier jeder Art lag ihm fern. Wenn er seine Gemüsesuppe hatte und ein Glas Wasser, war er zufrieden.
Diese kulinarische Bedürfnislosigkeit haben sich die ihm untergebenen Hamburger nicht zu eigen ge-macht. Er hatte auch nicht viel Zeit, sie mit christli-cher Beharrlichkeit dazu zu erziehen. So wurde die kulinarische Bedürfnislosigkeit des Ansgar weder eine Eigenart der Hamburger noch ein Brauch.
Überhaupt hatte Ansgar in Hamburg nicht viel Glück. Im Jahre 845 erschienen aus Schleswig-Holstein die heidnischen Wikinger mit einer Flotte von 600 Schiffen vor Hamburg. Sie eroberten die Stadt, die damals noch keine war, sondern eine kleine Fischer- und Handwerkersiedlung. Burg, Kirche und Kloster – alles Holzbauten – wurden niedergebrannt. Hamburg war – so wie es aussah – ausgelöscht.
Ansgar und seine Mitarbeiter retteten ihr nacktes Leben und nahmen nur einige ihnen anvertraute hei-lige Reliquien mit, darunter die des heiligen Remi-gius, der im Jahre 498 den König Chlodwig I. getauft haben soll. Wer aus dem damaligen Hamburg nicht flüchten konnte, wurde getötet oder kam in Gefangenschaft, was gleichbedeutend war mit Sklaverei.
Ansgar flüchtete über die Elbe, blickte zurück auf die brennende Hammaburg und sagte: »Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen. Wie es dem Herrn gefiel, so geschah es. Der Name des Herrn sei gepriesen. »Ändern konnte er sowieso nichts.
Er und seine Brüder gerieten in große Not und bliesen, wie ihnen nichts Besseres einfiel, Trübsal. Sie zogen mal hierhin, mal dorthin und fanden keinen festen Wohnsitz, bis sich die Edelfrau Ida warmen Herzens des Bischofs annahm. Sie schenkte ihm das Gut Ramelsloh bei Harburg.
Später setzte König Ludwig der Fromme Ansgar auf den verwaisten Bischofsstuhl in Bremen. Der nahm – mit Segen Ludwigs – den Titel eines Erzbischofs von Hamburg mit. So wurde er Erzbischof von Hamburg und Bremen mit Sitz in Bremen. Bremen deswegen, weil die Stadt an der Weser in etwas sichererer Entfernung von den Wikingern lag.
Nachdem die Zeiten ruhiger geworden waren, kümmerte sich Ansgar wieder mehr um Hamburg, verkehrte aber mit den Hamburgern nach Möglichkeit nur schriftlich, was schon – für die Boten – gefährlich genug war, jedoch für Ansgar nicht lebensbe-drohlich.
Ein von den Wikingern abgefangener Brief war zwar für alle Zeiten verloren, hatte aber keine Auswir-kungen auf das Leben in Hamburg, zumal die Wi-kinger nicht lesen konnten.
Es soll hier nicht die Kirchengeschichte Hamburgs erzählt werden. Das hat Adam von Bremen bereits 1072 ausführlich getan,
Auch die Geschichte der Wenden ist in diesem Zusammenhang nur dadurch interessant, dass die Wenden immer wieder und wieder versuchten, die Hamburger zu zwicken und Hamburg zu zerstören, was für sie zu einem gern geübten Brauch wurde.
Fast wäre es ihnen sogar gelungen, Hamburg zu entvölkern.
Es sollen immerhin 600 Hamburger Familien gewesen sein, darunter viele geborene Hamburger, die schließlich die Nase derart voll hatten, dass sie be-schlossen, auszuwandern.
Sie zogen in den Harz.
Dafür kamen Niederländer, Westfalen und Friesen nach Hamburg.
Am Ende hockten in Hamburg lauter Quiddjes, sodass es gar nicht so einfach ist, die Eigenarten der in Hamburg lebenden Menschen unter einen Hut zu bringen.
Einen seit Generationen in Hamburg lebenden Hamburger kann man vor allem am Dialekt erkennen und an seiner Liebe zum Ochsenfleisch.
Die Schwäne auf der Alster schmecken tranig, aber sie sind Garanten für die Unabhängigkeit der Stadt
Wie schmeckt eigentlich Alsterschwan?
Das ist nun wirklich eine Frage, die man einem Hamburger nicht stellen sollte.
Denn erstens ist es verwerflich und sowieso streng verboten, einen Alsterschwan in den Ofen zu schie-ben, um ihn anschließend zu verspeisen.
Zweitens schmeckt Alsterschwan tranig.
Aber der Reihe nach.
Tatsächlich ist der Schwan unter den Entenvögeln nicht nur das kräftigste, gelassenste und majestä-tischste Tier. Der Schwan hat auch den längsten Hals. Außerdem gilt er als »König unter den Wasservögeln«.
Er ist ein Sinnbild kampfzorniger und stürmischer Gemütsart, was ihm schon der süddeutsche Schriftsteller Konrad von Magenberg im Jahre 1350 bestätigt hat.
Magenberg schrieb, der Schwan sei von »einer hei-ßen Natur, darüber hinaus ist er zornig!«
Die Stormarner, sehr geschätzte Nachbarn der Hamburger, haben den Schwan sogar als Wappenbild gewählt, um damit ihrer Wesensart gebührenden Ausdruck zu verleihen.
Merke: Es empfiehlt sich nicht, sich mit einem Stormaner anzulegen.
In alten Zeiten war die Haltung von Schwänen den Königs- und Fürstenhöfen vorbehalten. Die Stadt Hamburg schmuggelte sich dazwischen.
Schwäne dienten nicht nur als Schmuck für die herrschaftlichen Gewässer. Sie waren auch eine Zierde der Festtafeln, wobei das etwas zähe und häufig öligfette Fleisch des Schwans während der Renaissance am Spieß gebraten wurde.
Später galt das Fleisch der jungen Schwäne als Pas-tetenfüllung.
Ausgestopfte Alsterschwäne mit vergoldeten Flü-geln zierten zum Beispiel die Tafel der Matthiae-Mahlzeit. Mit ihren Flügeln bedeckten sie die Schwanen-Pastete, die von den Gourmets als Hochgenuss gefeiert wurde. Dass man hinterher nach Tran aufstoßen musste, sah ja keiner.
Elisabeth II., Königin von Großbritannien, gehören noch heute alle Schwäne in ihrem Land, und alle Alsterschwäne gehören dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg.
Das war aber nicht immer so.
Die Schwäne auf den hamburgischen Gewässern gehörten ursprünglich den Schauenburger Grafen, die zwar von der Oberweser stammten, aber an der Elbe das Sagen hatten.
Nachdem die Schauenburger Elbegrafen ausgestorben waren, schickten sich die Hamburger an, sich selbstständig zu machen, was ihnen auch mit sehr viel diplomatischem Geschick gelang.
Mit der Selbstständigkeit übernahmen die Hamburger auch die Schwäne, allerdings auch den Appetit auf die langhalsigen Entenvögel, eine Eigenart, die in Hamburg nicht ungewöhnlich ist.
Der Appetit der Hamburger auf Schwanenfleisch muss aber größer gewesen sein als das Vermehrungsbedürfnis der Hamburger Schwäne.
So ist es zu verstehen, dass der Rat der Stadt Ham-burg im Jahre 1664 den Bürgern ausdrücklich verbot, Schwäne in die Röhre zu schieben, am Spieß zu braten oder sonst wie zu genießen. Es wurde sogar bei Strafe verboten, die Schwäne zu beleidigen.
Gesetzt den Fall, die Schwäne hätten eventuelle verletzende Äußerungen verstanden – was dann?
Sie hätten die Alster möglicherweise für immer verlassen. Und damit wäre die Unabhängigkeit der Stadt für alle Zeiten verloren gewesen.
Denn – so prophezeite man in Hamburg noch im 17. Jahrhundert – wenn die Schwäne verschwinden, verliert Hamburg seine Freiheit.
Das haben die Schwäne von Hamburg bis heute gemeinsam mit den Affen von Gibraltar. Wenn die Af-fen von dem Felsen verschwunden sind, endet auch die Herrschaft der Briten über die Festung am Ein-gang zum Mittelmeer.
Ähnlich geht es den Bremern mit ihrem Roland. Wenn der Roland stürzt, so heißt es, ist es mit der Freiheit von Bremen vorbei.
Der Roland kann allerdings nicht wegfliegen, und wenn doch: Im Ratskeller soll ein Ersatzroland ste-hen.
Der Glaube der Hamburger an den möglichen Verlust ihrer Selbstständigkeit hat sich im Laufe der Jahrhunderte verflüchtigt. Aber man kann ja in unserer globalisierten verrückten Welt nie wissen, was noch alles geschieht. Kiel als Landeshauptstadt pocht – wenn auch zaghaft – an die Rathaustür.
Da ist es schon ganz vernünftig, dass es seit dem Jahre 1818 einen eigens für die Alsterschwäne gedachten städtischen »Schwanenvater« gibt, der die derzeit etwa 120 Höckerschwäne betreut.
Den Winter verbringen die Tiere auf dem eisfrei gehaltenen Eppendorfer Mühlenteich. Im Sommer lassen sie sich auf der Alster als »Wahrzeichen Ham-burgs« bestaunen – ohne Scheu und ohne Angst vor der Röhre.
Die Hamburger wollen keine Steigbügelhalter sein – und Kaiser Wilhelm war beleidigt
Probleme mit gekrönten Häuptern hatten die Ham-burger seit eh und je. Denn gekrönte Häupter dünken sich im Allgemeinen als etwas Besseres, was sich die Hamburger überhaupt nicht vorstellen können.
Was ist schon ein gekröntes Haupt gegen einen Hamburger?
Ärgerlich war das Verhältnis zu König Waldemar II. (1202 – 1241) von Dänemark.
Der wollte nicht nur die Ostsee mit allem Drumherum unter seine Fuchtel bringen, sondern auch die Stadt Hamburg, was ihm sogar vorübergehend gelungen ist. Von 1202 bis 1227 gehörte Hamburg zu Dänemark, was schon an sich schlimm genug war.
Noch schlimmer war es, dass Waldemar gelegentlich auf einen gnädigen Schnack vorbei kam, was ihm die Hamburger nicht verbieten konnten.
Bei solchen Gelegenheiten wurde der allergnädigste König vom Bürgermeister der Stadt vor dem Rathaus begrüßt und auch wieder verabschiedet, was ja auch üblich war.
Leider kam der Bürgermeister dabei nicht umhin, dem König den Steigbügel zu halten. Eine für einen Hamburger geradezu entwürdigende Prozedur, die aber für künftige Generationen Folgen haben sollte.
Nach dem dänischen Abenteuer beschloss der Rat der Stadt, offizielle Gäste künftig im Obergeschoss des Rathauses, an der Senatstreppe, zu begrüßen und dort auch zu verabschieden.
Dorthin kam niemand hoch zu Ross.
Es sind allerdings freundliche Ausnahmen gestattet worden.
Als die britische Königin Elisabeth II. im Jahre 1965 Hamburg besuchte, wurde sie von Bürgermeister Paul Nevermann (1902 – 1979) vor dem Rathaus begrüßt.
Nevermann wusste, dass die Königin nicht zu Pferd nach Hamburg gekommen war. Sie war zusammen mit ihrem Mann, Prinz Philipp, mit einem Sonderzug angereist, den sie am Dammtorbahnhof verlassen hatte.
Die so von Nevermann geehrte Elisabeth revanchierte sich mit dem Ausspruch, Hamburg sei »Aufregend schön«. Danach fuhr sie vom Hamburger Hafen aus mit ihrer königlichen Yacht »Britannia« zurück in die Heimat.
Die Ausnahmeregelung galt nicht für Kaiser Wil-helm II., der Hamburg im Jahre 1895 aus Anlass der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Kanals besuchte.
Der Kanal heißt heute Nord-Ostsee-Kanal, was den Kaiser nicht mehr kränken kann. Gekränkt aber war er, dass sich der Senat damals weigerte, ihn am Eingang des Rathauses zu empfangen.
Das Rathaus war 1895 noch gar nicht fertig und der Kaiser besuchte im Grunde eine Baustelle. Aber der für ihn hergerichtete Raum erhielt den Namen »Kaisersaal«. Geschmückt aber wurde der Kaisersaal mit den Büsten Bismarcks, Moltkes und – Kaiser Wil-helm I.
Der Senat soll dann doch etwas Fracksausen vor der eigenen Courage bekommen haben. Dort, wo Kaiser Wilhelm II. begrüßt worden war, erinnerte fortan eine Bronzetafel an dieses historische Ereignis.
Merke: Gekrönte Häupter tun gut daran, in Hamburg bescheiden aufzutreten.
Wie Graf Otto nicht nach Hause finden konnte und St. Pauli zu Hamburg kam
Es war an einem freundlichen Tag des außerordent-lich friedlichen Jahres 1429.
Graf Otto von Schauenburg, der in Pinneberg residierte, hatte mal wieder Lust nach Hamburg zu reiten, wo stets ein reservierter Stammplatz im Ratsweinkeller unten im Eimbeck’schen Haus auf ihn wartete.
Graf Otto war ein Freund eines guten Trunkes, den er in der Hamburger Qualität in Pinneberg schmerz-lich vermisste.
Außerdem genoss er die Gesellschaft des Hoch- und Wohlweisen Rates, dessen Mitglieder er meistens im Ratsweinkeller traf und die ihn von ihren besten Weinen, Rheingauweinen, versteht sich, großzügig kosten ließen.
Der Wein wurde frisch vom Fass gezapft und in einem Deckelglas, dem Römer, aufgetragen.
An diesem freundlichen Tag hatte sich Graf Otto viel zu lange im Ratsweinkeller aufgehalten. Es war aber auch zu schön und sehr anregend gewesen. Es war bereits später Abend, als der Graf den Keller verließ.
Mit Beginn der Dunkelheit aber wurden die Tore der Stadt Hamburg geschlossen – und zwar für jeder-mann, auch für einen Grafen Otto von Schauenburg.
Da bot ihm der gastfreundliche Bürgermeister Hin-rich vom Berge eine Herberge in seinem Privathaus an, was dem Pinneberger sehr willkommen war. Wo hätte er auch sonst standesgemäß nächtigen sollen?
Die Frau des Bürgermeisters empfing den hohen Gast mit freundlichen Worten und kredenzte ihm ohne weitere Umstände einen Goldpokal voll des edlen Weines. Die vom Berges hatten, wie alle Hamburger, die auf sich hielten, einen guten Weinkeller.
Man schnackte über dieses und jenes. Die Frau des Bürgermeisters, eine blitzgescheite Dame, brachte zu fortgeschrittener Stunde das Gespräch auf ein Grundstück zwischen Millerntor und Altonaer Grenzbach, das dem Grafen gehörte. Der Rat der Stadt Hamburg hatte – wie die Bürgermeisterin wusste – ein begehrliches Auge darauf geworfen.
Tatsächlich schaffte sie es mit ihrem Hamburger Charme, dem geographisch wohl nicht besonders hellen Grafen von seinem erblichen Eigentum das Gebiet um St. Pauli zu entlocken.
Es handele sich ja nur um »dat lütte Räumeken«, wie die Frau des Bürgermeisters es nannte, damit die Hamburger Frauen einen kleinen Platz hätten, ihre Linnen zu bleichen.
Als sich Graf Otto am nächsten Morgen, nach einem ausgedehnten und überdies guten Frühstück, von seinen Gastgebern verabschiedet hatte und nach Hause ritt, berührte er auch »dat lütte Räumeken«, das er der Stadt Hamburg in der vergangenen Nacht geschenkt hatte.
Danach wusste er nicht genau, ob er sich ärgern sollte über seine Dummheit oder ob er lachen sollte über die List und die Beredsamkeit der Bürgermeisterin.
Zu seiner Ehre sei gesagt: Er hat gelacht.
Aber er hat nie wieder die Stunde des Torschlusses verpasst.
Weinkenner unter sich und der Beigeschmack eines Rheingauers
Es mag wohl so um 1700 gewesen sein, da ereignete sich im Ratsweinkeller eine staunenswerte Geschichte, die übrigens nicht nur für Hamburg erzählt wird. Sie soll sich auch in anderen Städten zugetragen haben. Doch in Hamburg ist sie schriftlich über-liefert worden.
Das Schriftstück ist inzwischen verloren gegangen. Aber das macht nichts.
Doch nun zu der Geschichte.
Zwei talentvolle Hamburger Weinkenner, die einen Stammplatz im Ratsweinkeller hatten, der ihnen auch zustand, wollten einmal das Zartgefühl ihrer Zungen an einem Fass Rheingauwein von etwa sechs Oxhoft Inhalt erproben.
Das Wort Oxhoft stammt aus dem niederdeutschen Oxhoofd gleich Ochsenhaupt beziehungsweise Ochsenkopf und ist verwandt mit dem englischen hogs-head gleich Schweinskopf und dem französischen barrique.
Ein Oxhoft, Maß für Wein und Spirituosen, fasste etwa 200 Liter. Sechs Qxhoft waren demnach 1.200 Liter. Unter diesen Umständen ist es für heutige Ze-cher unbegreiflich, dass der Romanschriftsteller Karl Leberecht Immermann (1796 – 1840) über ein ihm bekanntes Mitglied der menschlichen Gesellschaft schrieb: Er »führt mit Anstand zu den Lippen, eins der beiden Oxhoft-Fässer«.
Aber das sei nur am Rande vermerkt.
Vor einem solchen Fass jedenfalls saßen die beiden Hamburger Weinkenner. Sie probierten, schlürften, kosteten bedächtig und nachdenklich und ließen sich mehrere weitere Proben geben.
Der Wein war gut, da gab es kein Vertun. Es war ein edles Gewächs. Die beiden kannten die Lage. Rü-desheim im Rheingau, nur Sonne!
»Alles wahr«, meinte der eine.
Der andere fügte hinzu: »Dennoch …!«
Es gab da einen gewissen Beigeschmack, über den sie sich nicht einigen konnten.
Der eine behauptete, der Wein enthalte ein wenig Eisenoxyd. Der andere tippte auf Leder, nur sehr wenig – aber es war Leder!
Es kam zum Streit. Die beiden Weinkenner kauften das Fass, zogen den Wein auf zwei kleine Fässer ab, um jeder für sich zu trinken und zu testen.
Ehe es dazu kam, fanden sie am Boden des großen Fasses des Rätsels Lösung: einen eisernen Schlüssel an einem kleinen Lederriemen.
Stühlerücken am Petriabend und was es mit der Bursprake auf sich hat
Nahezu alles Bedeutende in Hamburg war und ist mit Essen und Trinken verbunden, mit einem Fest-mahl, um genau zu sein. Wenn aber in alter Zeit das Bedeutende noch bedeutender war, dann gab es auch schon mal eine Gasterei in zwei Akten.
Ein Beispiel dafür waren bis zum Jahre 1724 die Petri- und Matthiae-Mahlzeiten am 21. und am 24. Februar.
Die beiden Gastereien wurden ausgerichtet vom hohen Senat der Stadt Hamburg – und das seit Jahr-hunderten. Die erste Matthiae-Mahlzeit wurde am 24. Februar 1356 aktenkundig. Und wo die Matthiae-Mahlzeit war, konnte zu jener Zeit die Petri-Mahlzeit nicht weit weg sein.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.