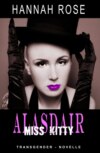Buch lesen: «Joshua - Ladybug»

Joshua
Ladybug
Transgender – Novelle
Hannah Rose
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar
1. Auflage
Covergestaltung:
© 2021 Thomas Riedel
Coverfoto:
© 2021 depositphotos.com
Dieses Werk enthält sexuell explizite Texte und erotisch eindeutige Darstellungen mit entsprechender Wortwahl. Es ist nicht für Minderjährige geeignet und darf nicht in deren Hände gegeben werden. Alle Figuren sind volljährig, nicht miteinander verwandt und fiktiv. Alle Handlungen sind einvernehmlich. Die in diesem Text beschriebenen Personen und Szenen sind rein fiktiv und geben nicht die Realität wieder. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen oder Orten sind rein zufällig. Das Titelbild wurde legal für den Zweck der Covergestaltung erworben und steht in keinem Zusammenhang mit den Inhalten des Werkes. Die Autorin ist eine ausdrückliche Befürworterin von ›Safer Sex‹, sowie von ausführlichen klärenden Gesprächen im Vorfeld von sexuellen Handlungen, gerade im Zusammenhang mit BDSM. Da die hier beschriebenen Szenen jedoch reine Fiktion darstellen, entfallen solche Beschreibungen (wie z.B. das Verwenden von Verhütungsmitteln) unter Umständen. Das stellt keine Empfehlung für das echte Leben dar. Tipps und Ratschläge für den Aufbau von erfüllenden BDSM-Szenen gibt es anderswo. Das vorliegende Buch ist nur als erotische Fantasie gedacht. Viel Vergnügen!
Impressum
© 2021 Hannah Rose
Verlag: Kinkylicious Books, Bissenkamp 1, 45731 Waltrop
Druck: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN siehe letzte Seite des Buchblocks
»Transgender zu sein, schwul, groß, klein, weiß, schwarz,
männlich oder weiblich, ist ein weiterer Teil des menschlichen
Zustands, der jedes Individuum einzigartig macht
und über den wir keine Kontrolle haben.
Wir sind, wer wir sind, in den tiefsten Nischen unseres
Verstandes, unseres Herzens und unserer Identität?«
Linda Thompson, (*1950)

Prolog
Es war nicht gerade Joshuas bestes Jahr, und wenn er ehrlich zu selbst war, dann war es mit Sicherheit das schlechteste überhaupt.
Es war sein letztes an der ›High-School‹ und es hatte bereits furchtbar angefangen. Er erschien zu seinem ersten Schultag und sah alle seine Freunde seit Juni wieder. Sie waren alle mindestens vier Zoll größer als er und wie er schätzte an die dreißig Kilo schwerer. Zumeist waren sie den Sommer über regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, um ihre Muskeln zu trainieren, in der stillen Hoffnung, dass ihnen ein ordentliches ›Six-Pack‹ im letzten Schuljahr bei den Mädchen helfen würde. Er hätte gern das Gleiche getan, aber seine Eltern hatte die Ferien für ein großes Familientreffen genutzt, und von seinem Vater war er dazu gebracht worden, einen Job anzunehmen, bei dem er ›Hamburger‹ in einem ›Fastfood‹-Restaurant wenden musste. Und im Gegensatz zu seinen Freunden war bei ihm ein weiterer Wachstumsschub ausgeblieben. Es reichte der Natur einfach nicht, dass er bereits um einiges kleiner war als alle Jungs seiner Klasse – jetzt war er nicht mehr viel größer als die meisten Mädchen.
Dennoch er entschied sich dazu, es sich nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen und das Beste aus seiner Größe zu machen – so hatte er sich zum Beispiel am ›St. Patrick’s Day‹ verkleidet.
Mittlerweile wollten auch seine ›Freunde‹ nicht mehr mit ihm abhängen. Alle waren Mitglieder in den verschiedenen Schulmannschaften, in denen auch er sich ausprobiert – aber direkt geschnitten worden war – weshalb er es anderweitig versucht hatte. Er war sogar dem Schach- und dem Theaterclub beigetreten, aber selbst diese Jungs wollten mit ihm nichts zu tun haben, weil er sowohl im Schach- als auch im Schauspiel ein echter Versager war. Letztlich durfte er die Schachfiguren und Spielbretter verwalten und sich im Dramaclub als Beleuchter betätigen – was ihm nicht sonderlich schwerfiel, weil es nur zwei Lichter gab.
Sein Jahr ging weiter bergab, als seine Eltern kurz vor Weihnachten bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben kamen. Ein Schwertransporter war in ein Stauende gerast und hatte auf der ›M5‹ ein Bild des Grauens hinterlassen.
Am Ende hatte ihm einer seiner Lehrer eine vorübergehende Unterkunft angeboten, weil sonst niemand bereit gewesen war, ihn aufzunehmen. Bei ihm hatte er die nächsten zwei Monate auf einer Ausziehcouch geschlafen, während seine schulischen Leistungen abgerutscht waren – wenngleich er überrascht war, wie nachsichtig seine Lehrer in der Notengebung mit im umgingen, immer in der Erwartung, dass er dann wenigstens zu all seinen Prüfungen erscheinen würde. Aber seit er faktisch Vollwaise geworden war, fiel ihm das Lernen zunehmend schwerer und schwerer.
»Wenn deine Noten sich nicht verbessern, wirst du das Jahr wohl wiederholen müssen«, hatte ihn sein Lehrer wissen lassen. Und schon bei dem Gedanken daran hatte sich sein Magen umgedreht – denn er hatte gehofft, dass man ihm nach dem schweren Schicksalsschlag ein wenig mehr entgegengekommen wäre und geschont hätte.
Ja, er konnte unumwunden sagen, dass es das schlimmste Jahr seines Lebens war. Und er betete inständig, dass das kommende, das Ende seiner Probleme einläuten würde – nicht wissend, dass seine tatsächlichen Schwierigkeiten gerade erst begannen ...


Kapitel 1
Als Joshua an diesem Nachmittag von der Schule nach ›Hause‹ kam, sah er seine Tante Rhianna in der Küche seines Lehrers sitzen
Sie erhob sich und lächelte, als sie ihn sah. »Josh! … Das ist schön dich zu sehen. Es scheint schon eine Ewigkeit her zu sein.«
Ja, ist es tatsächlich, dachte er, denn es musste bereits über zehn Jahre her sein, dass sie ihre Schwester, seinen Vater und ihn in London besucht hatte. Nicht einmal zur Beerdigung seiner Eltern war sie erschienen. Im ersten Augenblick konnte er sich nicht einmal an ihren Namen erinnern, und es dauerte ein wenig, bis er ihm einfiel.
»Ich bin hergekommen, um dich mitzunehmen. Noch heute. Von jetzt an wirst du bei mir wohnen«, brachte sie ihm möglichst schonend bei. »Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis mich die Behörden als Erziehungsberechtigte anerkannt haben.«
»Aber ich dachte, du lebst auf der ›Isle of Man‹«, murmelte er.
»Das stimmt, … und genau dorthin werden wir aufbrechen«, erwiderte sie mit einem breiten Lächeln.
Es war eines von der beunruhigenden Art, und fast wäre er in Tränen ausgebrochen, als ihm in den Sinn kam, dass einen Szenenwechsel vielleicht wirklich eine gute Sache sein könnte. Es ist ja schließlich nicht gerade so, als ob mich etwas in London halten würde, dachte er still.

Bereits eine Stunde später saß er ihrem Wagen und befand sich auf dem Weg nach Liverpool, um von dort auf einer Fähre die fast dreistündige Überfahrt nach Douglas auf der Insel anzutreten. Zum überwiegenden Teil war es eine stille, ruhige Fahrt. Zuerst versuchte Rhianna noch ein Gespräch mit ihm zu führen, doch gab sie auf, als sie feststellte, dass sie und er so absolut nichts gemeinsam hatten.
»Du wirst die Insel ganz sicher mögen, glaub' mir«, wiederholte sie mehrfach, als wollte sie ihn mehr als sich selbst davon überzeugen, im Versuch ihn ein wenig aufzumuntern.
Sie übernachteten in Liverpool in einem preiswerten Motel, ehe sie am frühen Morgen auf die Fähre fuhren. Als seine Tante am nächsten Tag das erneut das Outfit vom Vortag trug, glaube er, dass sie überhaupt nur dieses eine für die Reise eingepackt hatte. Es entsprach auch irgendwie dem Einzigen, was er von ihr wusste – denn seine Mutter hatte ihm einmal erzählt, dass ihre Schwester schon immer ein Hippie gewesen sei. »Sie lief von zu Hause weg, als ich neun Jahre alt war«, hatte sie ihm gesagt, »um in irgendeiner Kommune zu leben. Das war sie gerade erst sechzehn. Es hat dann viele Jahre gedauert, bis ich sie wiedergesehen habe … Typisch Rhianna. Sie war schon immer ein bisschen komisch.«
Sie standen auf dem Oberdeck und schauten auf die Irische See, als er sie schließlich fragte: »Stimmt es, dass du ein ausgeflippter Hippie gewesen bist?« In seiner Stimme schwang die Besorgnis mit, von nun an ebenso leben zu müssen.
Rhianna lachte. »Das hängt davon ab, was du unter ›ausgeflippt‹ verstehst«, antwortete sie.
Joshua interpretierte ihre ausweichende Antwort als ein ›Ja‹.
»Du wirst die Insel mögen … Wirklich, Josh«, wiederholte sie erneut, als würde er es ihr vielleicht diesmal glauben.
Joshua musste sich eingestehen, dass er die feuchtkalte Luft jetzt schon hasste. Seine Kleidung fühlte sie nass und klamm an. Außerdem schmerzte ihm der Rücken von dem miserablen Motel-Bett, und er hoffte, dass sein neues deutlich bequemer sein würde. »Wo genau lebst du denn auf der Insel? In Castletown oder Mount Murray?«, fragte er die beiden einzigen Orte ab, die er auf der ›Isle of Man‹ kannte.
»Irgendwo am Rand«, erwiderte sie kryptisch mit einem kleinen Lächeln.

Nach dem Verlassen der Fähre in Douglas mussten sie noch gut eine Dreiviertelstunde fahren, um zu Rhiannas Haus in Scartfield an der Westküste der Insel zu gelangen. Es war ein recht kleines mit nur zwei Schlafzimmern, einem Wohnzimmer und einer nicht allzu großen Küche. Eine Seite des Grundstücks war stark bewaldet, während die andere, einen überraschend schönen Meerblick bot.
»Das ist es, … dein neues, … unser Zuhause«, sagte sie, während sie ihm alles zeigte.
Sein Zimmer war klein und kaum groß genug für das Doppelbett darin – und er fragte sich unweigerlich, wie sie die Schlafstätte durch die schockierend schmale Tür bugsiert hatte.
Jede einzelne Diele im Haus knarzte und es gab nahezu keine Stelle, in der man nicht einen gewissen Luftzug verspürte. Er holte sein ›iPhone‹ heraus und musste frustriert feststellen, dass es keinen Empfang gab. »Gibt es ein Festnetz?«, wollte er wissen.
»Nein, Josh. Es gibt aber ein kleines Internetcafé in Jurby, eine Viertelstunde zu Fuß von hier ... Aber bei all der schönen Natur braucht man ja auch kein Internet.«
Joshua machte ein langes Gesicht. Sein einziges Hobby waren Videospiele, und seine wenigen Freunde, hatte er beim wettkampforientierten ›League of Legends‹ gefunden. Natürlich hatte er niemanden von ihnen je persönlich getroffen, aber er hatte sich oft über Stunden mit ihnen über ›Discord‹ ausgetauscht, auch wenn sie einmal nicht gespielt hatten. Jetzt aber sah er seine Felle davonschwimmen, denn es gab keine Möglichkeit mit ihnen zu kommunizieren. »Und wo gehe ich zur Schule?«, fragte er seine Tante niedergeschlagen.
»In Douglas. Ich habe dich in der ›St. Ninian’s High-School‹ angemeldet. Es fahren regelmäßig Busse von Jurby aus … Ich habe das schon alles für dich organisiert.«
Er fühlte, wie ihm schlecht wurde. »Eine Viertelstunde Fußweg bis Jurby. Dann eine Dreiviertelstunde mit dem Bus nach Douglas? Zweimal am Tag? Das glaub‘ ich jetzt echt nicht!«, hielt er ihr vor.
»Die frische Luft wird dir guttun, Josh«, meinte sie mit einem warmen Lächeln, dass ein wenig herablassend wirkte.
Trotz all dem verlor er nicht die Hoffnung daran, dass sich sein Leben auf der Insel zum Positiven verändern würde.

Aufgeregt machte er sich am nächsten Tag auf den Weg zu seiner neuen Schule, neugierig darauf, wie wohl seine Klassenkameraden sein würden. Aber auch hier auf der Insel musste er schon nach wenigen Stunden feststellen, dass niemand etwas mit ihm, dem ›Neuen‹, zu tun haben wollte. Also nahm er seufzend zur Kenntnis, dass es nur noch fünf Monate bis zum Abschluss waren und viel zu spät, um noch Anschluss zu finden.
Doch in dem Moment, da er schon innerlich kapitulieren und die weiße Fahne schwenken wollte, kamen ein paar Mädchen auf ihn zu und fragten, on er nicht mit ihnen abhängen wollte. Nur zu gern war er bereit zu nehmen, was sich ihm bot, worauf er die meiste Zeit der Mittagspause mit ihnen verbrachte, bis eines der Mädchen meinte: »Ich finde das ja echt cool, dass wir jetzt mal einen schwulen Typen an unserer Schule haben.«
Joshuas wurde flau im Magen, als er bemerkte, dass sie ihn damit gemeint hatte. Wow! Na, da scheint sich ja schnell ein Gerücht breitgemacht zu haben. Die denken also alle, dass ich schwul bin, dachte er schockiert.
»Wieso denkt ihr, dass ich schwul bin? … Bin ich nicht«, reagierte er schüchtern. »Ich mag Mädchen … Und ich würde es dir sogar beweisen, wenn du mit mir in ein leeres Klassenzimmer kommst.«
Die Blondine hatte darauf angewidert gekeucht und ihm bedeutet sich doch einen anderen Tisch zu suchen.
Er hatte ihr verbal etwas entgegengeschleudert. Vermutlich weil er es einfach satthatte, immer und überall herumgeschubst zu werden – und begann zu akzeptieren, dass er den Rest des Schuljahres würde allein verbringen müssen.
Auch in den nächsten Tagen wurde das Mobbing nicht weniger. Jemand sprühte sogar das Wort ›Schwuchtel‹ auf sein Schließfach und Mitschüler stichelten, wann immer sich ihnen die Möglichkeit dazu bot. Es wurde sogar so schlimm, dass er mit einem blauen Auge nach Hause kam und sich entschied am darauffolgenden Tag die Schule zu schwänzen. Er war zwar bis zur Bushaltestelle in Jerby gelaufen, aber nicht zugestiegen und hatte den Rücklichtern mit den Tränen in den Augen nachgeblickt. Dann war er zu dem Internetcafé gelaufen, von dem ihm Rhianna erzählt hatte, um ein wenig mit seinen Spielfreunden zu chatten.
Letztlich hatte er nicht nur den Schultag geschwänzt, er hatte sich aufgegeben – und ernsthaft darüber nachgedacht, ob es nicht eine Online-Option zum Lernen gab.
Ehe sich sein Körper weiterentwickelt hatte, wollte er keinesfalls wieder zur ›High-School‹ gehen – und so langsam begann er zu glauben, dass dies niemals geschehen würde. Dass der Körper, den er nun einmal hatte, für immer so bleiben würde.
Zumindest dachte er es …


Kapitel 2
Schon nach kurzer Zeit fand Joshua heraus, dass seine Tante keiner geregelten Arbeit nachging, obwohl sie keinen schlechten Lebensstandard pflegte. »Womit verdienst du eigentlich dein Geld?«, fragte er sie eines Nachmittags. »Was hast du gelernt?«
»Ich hatte mein ganzes Leben noch keinen herkömmlichen Job, wenn du das meinst, Josh«, antwortete sie, als wäre sie stolz darauf.
»Dann hast du dein Geld als Prostituierte verdient, wie all diese Hippie-Mädchen?«, fragte er verschämt nach.
»Wie kommst du denn auf diesen Blödsinn?« Sie lachte belustigt auf. »Oh, nein! So etwas habe ich nie gemacht.«
»Und wie hast du das hier kaufen können?«
»Das war nicht teuer.« Ein stilles Lächeln umspielte ihre fein geschwungenen Lippen. »Ich habe das Haus vor fünfzehn Jahren gekauft. Es kostete knapp dreißigtausend Pfund. Für die Rückzahlung der Hypothek habe ich nicht einmal sechs Jahre gebraucht. Jetzt zahle ich nur noch die anfallende Grundsteuer … Und von Zeit zu Zeit muss natürlich auch mal etwas instand gesetzt werden.«
»Und woher kommt das Geld dafür?« Er ließ nicht locker. »Ich meine: Lebensmittel, Heizung, Auto … Allein mich aus London abzuholen, die Fähre und das Motel … Das hat doch alles was gekostet.«
»Wenn ich die Kasse wieder auffüllen muss, biete ich ein bisschen ›Consulting‹ an«, antwortete sie mit einem süffisanten Grinsen.
Für Joshua wurde es offensichtlich, dass sie ihm nicht erzählen wollte, womit genau sie ihren Lebensunterhalt bestritt – was ihn weiter vermuten ließ, dass sie doch heimlich der Prostitution nachging. Er musterte sie unauffällig.
Seine Tante war eine hübsche Frau Anfang der Fünfziger, immer noch attraktiv und begehrenswert, mit ihren langen blonden Haaren und den großen tiefblauen Augen. Da war etwas sehr Anziehendes in ihrem Auftreten – und etwas, dass er bei einer Frau erwarten würde, die ihren Kunden einen erstklassigen und hochpreisigen Escort anbot. Für ihn passte das gut zu der Tatsache, dass sie oft verschwand, ohne ihm zu sagen, wohin, und es nie danach aussah, als ob sie eine Besorgung erledigt hätte.
Er wagte es auch nicht, sie nach der Art des ›Consultings‹ zu fragen, weil er sicher war, ihr eh nicht zu glauben.
»Verrätst du mir, wie es in der neuen Schule läuft?«, fragte sie, das Thema wechselnd.
Joshua war überrascht, dass sie von der Schulleitung noch nicht darüber informiert worden war, dass er gar nicht hinging. Andererseits hat sie kein Telefon, sagte er sich, und man hat keine Möglichkeit gefunden, sie auf direktem Weg zu informieren. »Läuft ganz gut«, antwortete er ausweichend, wobei er es vermied, sie direkt anzusehen.
»Hast du schon irgendwelche Mädchen getroffen, die du magst?«, hakte sie nach.
Verwundert blickte er sie wegen der offen gestellten Frage nach seinem möglichen Liebesleben an. »Diese Oberstufen-Zicken sind nicht mein Typ«, murmelte er.
Rhianna lachte. »Ach, Quatsch! Die wollen sich doch ausprobieren. An die solltest du dich mal ranmachen«, meinte sie.
»Die sind doch blöd und behandeln einen von oben herab, als wenn sie was Besseres wären«, widersprach er. »Außerdem bin ich wohl kaum hier, um eine Freundin zu finden, oder? … Ich bin hier, weil meine Eltern tot sind, du die Vormundschaft hast, bis ich volljährig bin und ich meine Schule beende … Danach will ich wieder nach London … So schnell es geht. Das hier … ist nichts für mich.«
»Lass‘ dir Zeit, Josh. Dann beurteilst du es vielleicht schon bald anders. Ich bin sicher, dass du dich gut einleben und es dir sogar gefallen wird«, bat sie ihn mit einem Grinsen, als ob sie gerade einen tollen Witz vom Stapel gelassen hätte. »Ich fahre noch rüber nach Douglas. Benötigst du etwas, was ich für dich besorgen soll?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf.

Im Grund genommen war Joshua ganz froh, dass seine Tante noch einmal fortmusste und ihn eine Weile allein ließ. Schon über eine Woche hatte er nicht mehr masturbiert, was, wie er fand, einem fast Achtzehnjährigen bereits einen Eintrag ins ›Guinness-Book-of-Worldrecords‹ einbringen musste. Er wartete, bis er das Dröhnen ihres Motors nicht mehr hören konnte, ehe er ins Badezimmer eilte und sich auszog. Augenblicklich fing er an sich zu stimulieren, starrte auf seine Erektion und stellte fest, dass ihm etwas fehlte. Er hatte sich an die Pornoschnipsel auf ›Pornhub‹ gewöhnt und verfluchte sich, nicht zumindest einige auf seinen Laptop heruntergeladen zu haben. Aber wie hätte ich auch ahnen können, dass es hier kein Internet gibt, ging es ihm frustriert durch den Kopf – denn so hatte er nichts. Doch dann fragte er sich unwillkürlich, ob sie nicht vielleicht etwas in der Richtung hatte. Immerhin scheint sie doch ein ziemlicher Freigeist zu sein, dachte er still. Es wird ganz bestimmt irgendetwas im Haus zu finden sein, dass meine Masturbationssitzung bereichert.
Ohne weiter darüber nachzudenken schlich er sich in das Zimmer seiner Tante, um ihre Schubladen zu erkunden. Er war nicht überrascht, als er zwei Laden der großen Kommode mit heißen Dessous gefüllt vorfand. Sofort begann er darin herumzukramen, in der Hoffnung etwas zu finden – ein Magazin, eine ›Blue-ray-Disc‹ oder zumindest schmutzige Spielkarten. Aber da war weder das eine noch das andere. Also suchte er weiter.
In ihrem Nachttisch fand sie einige ›Sex-Toys‹: zwei Dildos, groß und etwas kleiner, rosafarben und schwarz, einen Analplug, Handschellen, eine Augenbinde und sogar einen Knebel. Er schauderte bei dem Anblick, als ihm bewusstwurde, dass er viel zu tief in ihre Intimsphäre eingedrungen war. Vorsichtig schob er die Sachen zur Seite, um auch weiter hinten in die Schublade schauen zu können. Doch da fanden sich nur noch mehr Dessous und weitere eindeutige Spielsachen. Und je mehr er fand, desto fester wurde er in seiner Überzeugung, dass sie dem horizontalen Gewerbe nachging. Wahrscheinlich ist sie gerade auf dem Weg zu einem Freier um nicht nur finanziell ›abzusahnen‹! Ein vielsagendes Grinsen umspielte seine Lippen, weil er ja auch gerade nichts anderes als abspritzen wollte.
Als er bereits jede Hoffnung fahren lassen wollte, wurde er doch noch fündig: es war ein Buch mit diversen Sex-Stellungen, ähnlich dem Kamasutra – und auf allen Fotografien, war das gleiche Paar zu sehen. Die Auflösung war für seinen Geschmack gerade noch akzeptabel, die Frau war recht sexy und der Typ hatte einen großen, dicken Phallus. Es war die Seite auf der die beiden die Position der ›Spanischen Krawatte‹ zeigten, die ihm den letzten Kick bereitete, als er masturbierte – sodass einiges von seinem Sperma auf die Brüste der Frau klatschte, unmittelbar auf Höhe der dunklen Eichel, weil er sein Glied nicht rechtzeitig zur Seite gerichtet hatte.
Sofort versuchte er die Nässe von der Abbildung zu bekommen, was ihm nicht wirklich gelang – und keine Minute später lag das Buch wieder an seinem alten Platz in der Schublade. Jetzt fühlte sich zwar ein wenig entspannter, fürchtete sich aber dennoch vor den noch anstehenden fünf Monaten, in denen er auf der Insel festsaß.

Nur eine Stunde später entschied er sich, sein lustvolles Treiben zu wiederholen, weil er nichts Besseres mit sich anzustellen wusste, obgleich es ein schöner Tag war. Noch immer hatte er nicht herausgefunden, was seine Tante damit zum Ausdruck bringen wollte, als sie ihm sagte: »Geh‘ doch mal nach draußen und genieße die Natur.« Ich weiß überhaupt nicht, was ich da genießen soll?, dachte er, während er aus dem Fenster seines Zimmers schaute. Ich werde wohl kaum auf die Bäume klettern, geschweige denn auf alle! Und auf eine sinnlose Wanderung habe ich auch keinen Bock … Außerdem muss ich eh schon jeden Tag so viel laufen … Und schwimmen? Bis zum nächsten Strand, an dem man gefahrlos ans Wasser kommt ist es mir zu weit … Hier kann man echt nichts anderes machen, als sich aus Langeweile einen runterzuholen! Und das, obwohl ich viel Zeit damit verbracht habe, das Haus und die Schränke zu durchstöbern, um etwas zu finden, womit man sich die Zeit vertreiben kann. Er musste lachen, weil er sogar bereit gewesen war, irgendein Brettspiel gegen sich selbst zu spielen – aber selbst so etwas war nicht zu finden. Alles was es gab, waren Kleider, Kleider und nochmals Kleider. Wenn er einmal von all dem Make-up, den diversen Lotionen, Cremes und Tinkturen, von denen er nicht einmal zu sagen wusste, wofür sie waren, absah.
Und wieder fragte er sich, was seine Tante eigentlich den ganzen Tag tat, abgesehen davon, von Zeit zu Zeit ein ›Consulting‹ zu machen. Nicht einmal Bücher zum Lesen hatte er finden können. Die einzigen, die es gab, waren die seiner Schule – und nach denen stand ihm nun so ganz gar nicht der Sinn.

Seine Tante war immer noch nicht zurück, als die Sonne bereits am Horizont unterging und seine Langeweile begann einen neuen Level zu erreichen. Es war Sonntag, was bedeutete, dass er am nächsten Morgen wieder früh aufstehen musste, um so zu tun, als würde er in die ›High-School‹ gehen – und er erwischte sich dabei, dass sich ein Teil von ihm wünschte, er würde hingehen, nur um etwas Sinnvolles tun zu können. Ja, er kam sogar auf den abstrusen Gedanken, dass es vielleicht möglich sei, mit niemandem außer seinen Lehrern zu interagieren. Er konnte ja schließlich auf den letzten Drücker kommen und direkt mit Schulschluss vom Gelände verschwinden. Oder er könnte sich einfach in Douglas herumtreiben, in der Hoffnung, nicht von seiner Tante erwischt zu werden. Doch letztlich konnte er sich nicht entscheiden, welche der Optionen die weniger langweilige war.

Der kostenlose Auszug ist beendet.