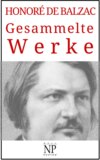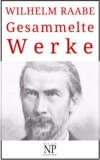Buch lesen: «Gabriele Reuter – Gesammelte Werke», Seite 8
»Mohren gehen – die gehen immer … Jäger mit Hunden werden auch gern gekauft.«
Frau von Woszenska bekam eines ihrer Bilder von der Münchener Ausstellung zurück. »Das Zeug will sich ja keiner in die Stube hängen – na – es war ’mal so ’ne Idee«, sagte sie philosophisch, indem sie es auspackte. Ein Turmfenster, das in dem Beschauer den Eindruck von schwindelnder Höhe, von Erdenferne und Himmelsnähe erweckte. Im Hintergrunde die Umrisse der großen Kirchenglocke. Und ein Kind blickt im Bogen des Fensters, den Kopf auf das runde dicke Ärmchen gelegt, ruhig hinab. Über ihm, an einem derben Haken, hängt eine tote Gans, auf ihrem flaumigen, mit der größten künstlerischen Delikatesse behandelten Gefieder glänzen still die letzten Sonnenstrahlen.
»– Tante Mariechen«, fragte Agathe, »wolltest Du damit sagen, dass ein vollkommener Friede nur durch eine Gans und ein Kind dargestellt werden kann?«
Frau von Woszenska lachte. »So kluge Bemerkungen musst Du den Hässlichen überlassen, dazu bist Du viel zu hübsch«, antwortete sie erfreut.
Agathe wurde es viel leichter, ihre Gedanken Woszenskis auszusprechen als ihren Eltern. In der unsicher tastenden Zagheit ihrer Empfindungen verwirrte sie schon die Ahnung eines Widerspruchs. Zu Hause war sie noch immer von Pädagogik umgeben. Hatte Frau Woszenska eine abweichende Ansicht, dann stellte sie sie als eine menschliche Anschauung einer anderen gegenüber. Und Kas war noch feinfühliger als seine Frau. Wo sie Philisterhaftigkeiten bemerkte, wurde ihr ganzes Gesicht gleich grausamer Hohn, auch wenn sie kein Wort sprach.
Nun geschah das seltsame, dass Agathe unter ihrem angelernten Geschmack etwas in sich fand, das damit gar nicht zusammenhing, das selbstständig, wenn auch sehr bescheiden und ängstlich, ein ihr selbst nur halb bewusstes Dasein geführt hatte. Sie bemerkte mit frohem Erstaunen, dass ihr Widerwille gegen die Langeweile, Gleichförmigkeit und Enge der gesellschaftlichen Sitten ihres Kreises, ja gegen die Grundsätze ihrer eigenen Eltern von Woszenskis völlig geteilt wurde.
Vieles, was ihr Vater als absurd und manieriert verdammte, stand hier in hohen Ehren.
So hatte Agathe ganz aus eigene Hand entdeckt, dass es einen großen Künstler gab, der Böcklin hieß, und dessen Bilder jedes Mal Sehnsucht und Glück in ihr weckten. Mit unbehaglichem Schweigen, als verleugne sie etwas Heiliges, hatte sie Walters und Eugenies Witze über ihn angehört. Die Tränen schossen ihr in die Augen, als sie Woszenski zum ersten Mal seinen Namen nennen hörte und er, was sie dunkel empfunden, mit geistreichem Verständnis pries. Ihr Wesen streckte sich gleichsam und wuchs und breitete sich aus in diesen Wochen.
Aber am meisten lernte sie doch von Lutz. Wie er war, und was er liebte, und wovon er bewegt wurde, suchte sie listig und mühsam zu erfahren. Es dünkte sie, als käme sie ihm auf eine geheimnisvolle Weise näher, indem sie ihn verstehen lernte.
Ihrem ersten Geliebten verdankte Agathe den Naturrausch, der sie bei jedem Sonnenuntergang in mystische Extasen versetzte – das Verständnis für die großen Konturen der Dinge und die schwärmende Begeisterung für eine weit, weit von allem Erdenweh entfernt wohnende Freiheit.
Der Don Juan, der sie durch seine Ironie verletzte, und den sie bis auf wenige Stellen nicht leiden mochte, hatte ihr dennoch den Blick für die Lächerlichkeit der Konvention geschärft.
Von ihrem zweiten Geliebten erlauschte sie nun den raffinierten Genuss an den Melodien der Farben, an ihren fernsten Abtönungen, und der Wirkung von Licht und Schatten – an den seltsamen Beziehungen zwischen Farbe und Seelenstimmung.
Adrian Lutz bedeutete ihr: in einem weiten Dunkel mit den beängstigenden Umrissen ungeheurer, unbestimmter Gestalten ein schmaler weißer Lichtstreif – eine zartleuchtende grünblasse Waldorchis.
Aus drei Radierungen und ein Paar Landschaftsstudien, die Woszenski von Lutz besaß und sehr hoch hielt, bildete Agathe sich eine Geschmacksrichtung: Modernste französische Schule mit etwas nervöser Romantik, die der Künstler aus dem ihm Eigenen hinzugetan.
Das war ein fremdes, scharfes Gewürz in ihrer bisherigen Nahrung. Ob der Regierungsrat Heidling gerade diese beiden Männer zu Erziehern seines Kindes gewählt haben würde?
Vorsichtige Eltern pflegen sich wohl einen Plan für die Bildung ihrer Töchter zu entwerfen. Aber die heimlichen Einflüsse, die am stärksten auf einen jungen Frauengeist wirken – die können sie nicht berechnen.
*
Einmal noch während ihres Aufenthaltes bei Woszenskis sah Agathe Lutz von weitem in einer menschenleeren Straße. Sie war dort auf und nieder gegangen, um die Zeit zu erwarten, wo sie ihm zu begegnen hoffte. Es war das erste Mal, dass sie so etwas tat, und sie konnte es auch nicht wiederholen – es zerriss sie zu sehr.
Er kam, die Zigarette zwischen den Lippen, aus seinem Atelier, traf auf den Postboten und nahm ihm einen Brief ab. Mit seinen hastigen Bewegungen riss er den Umschlag auf und schritt lesend ihr näher. Agathe ging langsam an ihm vorüber, ohne dass er sie bemerkte. Er blickte in die Höhe, sein bewegtes Gesicht strahlte vor Freude über die Nachricht, die er soeben empfangen hatte. Da fühlte sie tief, dass er mitten in einem reichen Dasein voll mannigfacher Erlebnisse stand – und sie hatte keinen Anteil daran – ihr war es ganz fremd.
Als fünf Wochen verflossen waren, reiste sie nach Haus zurück.
XI.
»Weißt Du, Agathe, wenn diese Woszenskis Dir so viel interessanter sind, als Deine eigenen Eltern, dann ist es am besten, wir treten Dich ihnen ganz ab. Dein Herz ist ja doch bei ihnen geblieben.«
»Ach, Papa – so mein’ ich’s ja nicht …«
»Aber lieber Ernst«, sagte die Regierungsrätin entschuldigend, »es ist doch hübsch, dass unser Kind uns von der Reise erzählt …«
»Das wollt’ ich mir auch ausgebeten haben«, sagte Heidling verstimmt, »vorläufig lasse ich sie nicht wieder fort, sonst findet sie uns nachher zu spießbürgerlich und langweilig.«
»Glaube mir nur, mein Kind«, redete der Regierungsrat weiter, »was Dich da geblendet hat, ist ein Wesen, in das Du mit Deiner soliden Natur Gott sei Dank gar nicht hineinpasst – es würde Dir bald genug zum Bewusstsein gekommen sein. So – nun gib Deinem alten Papa einen Kuss, wenn er auch kein Künstler ist, er meint es doch besser mit Dir, als Deine Woszenskis und wie die Leute da alle heißen.«
Frau Heidling kam eines Abends in ihrer Tochter Schlafzimmer. Sie setzte sich und sah zu, wie Agathe ihr langes braunes Haar kämmte.
»Mama, steht es mir besser, wenn ich die Flechte nicht mehr über den Scheitel lege, sondern so im Nacken trage? Eugenie sagt, es wäre viel moderner.«
Mutter und Tochter versuchten die neue Haartracht. Dabei sah die Rätin dem Mädchen in die Augen, wie sie es früher getan, wenn sie herausbekommen wollte, ob Agathe oder Walter genascht hatten, und fragte scherzhaft obenhin:
»Sag mal – Du – war denn Herr von Woszenski so sehr interessant?«
Agathe lachte.
»Sehr, Mama – wirklich – sehr – ach, er ist entzückend. Ich hab’ ihn zu gern!«
»Aber Kind – er ist doch ein verheirateter Mann …«
Die liebe Mama seufzte und sah ganz sorgenvoll aus. »Du bist so verändert, seit Du zurückgekommen bist …«
»Mama – nein!«
Agathe lachte noch viel übermütiger. »Du denkst, ich habe mich in Herrn von Woszenski verliebt?«
»Ein bisschen – natürlich nur ein bisschen!«
Frau Heidling legte die Arme um ihre Tochter und zog sie an sich, um ihr das Geständnis zu erleichtern.
»Sag’ mir’s, mein Kind!«
Agathe wand sich lachend los.
»Wirklich, Mama, davon ist ja keine Spur! Aber gewiss nicht! Ich schwärme ja nur für sie alle beide. Es sind so liebe, liebe Menschen!«
»Wenn Du’s sagst, glaube ich Dir ja – und – und – er hat sich doch nie eine Freiheit erlaubt?«
»Niemals, Mama«, rief Agathe empört. »Du machst Dir eine ganz falsche Vorstellung von ihm. Er ist ja so delikat. Nein – nein.«
Und nach einer Pause ganz leise, indem sie ihre Mutter küsste:
»Es war ein anderer, Mama – ich kann nicht … verlange doch nicht, dass ich darüber reden soll.«
Mama streichelte schweigend ihr Haar und ging mit dem Licht hinaus.
*
Nachdem Agathe an Frau von Woszenski geschrieben hatte, wartete sie täglich in atemloser Spannung auf deren Antwort. Vielleicht würde sie irgend etwas über Lutz schreiben. Oder wenn auch das nicht – Agathe verlangte so sehr danach, von ihr zu hören – den Poststempel der lieben, merkwürdigen Stadt zu sehen, wo ein neues Leben für sie begonnen hatte.
Endlich bekam sie einen Brief von Frau von Woszenski – sehr freundlich – aber viel zu kurz für ihre Wünsche.
Und später schrieb sie nur noch einmal wieder: sie hätte zu viel zu tun – nach dem Malen wären ihre Augen zu angegriffen, um zu korrespondieren – Agathe wisse doch, dass sie sie trotzdem nicht vergessen werde, und dass sie bald wiederkommen müsse.
Ja – ja – ja –. Agathe versuchte, sich mit der Hoffnung auf das Wiedersehen zu trösten.
Gott im Himmel! Warum gab sie nur immer gleich so viel von ihrem Herzen? Die Leute wollten es ja gar nicht haben! Wenn sie doch nur stolzer wäre!
*
Am 5. September las Agathe frühmorgens in der Zeitung eine Notiz: Fräulein Daniel war als Naive für das Theater in M. engagiert worden.
Sie hob das Blatt auf und barg es im Schreibtisch bei ihren Reliquien: einer Calicanthusblüte aus Bornau, die immer noch ein wenig duftete, der Manschette ihres Konfirmationsbouquets, Lord Byrons Fotografie und einer Rezension über die Berliner Ausstellung, in der Lutz erwähnt wurde. Tausendmal hatte sie den gedruckten Namen schon geküsst.
Ob Lutz am Ende seine Freundin bewogen habe, nach M. zu gehen, um sie hier zu besuchen und Agathe wiederzusehen?
Agathe hatte viel über das Verhältnis der beiden zu einander gegrübelt. Es war doch höchst unwahrscheinlich, dass zwei Menschen, die sich liebten, sich nicht schleunigst heirateten. Also liebte Lutz jedenfalls Fräulein Daniel nicht. Irgend etwas Besonderes musste dahinterstecken – ein Geheimnis. Konnten sie nicht Geschwister sein? Sie sahen sich doch wirklich ähnlich. – Wie schön – wie edel von Lutz, eine Schwester, die er aus Achtung vor der Ehre seines Vaters oder seiner Mutter nicht öffentlich anerkennen durfte, mit so heimlicher, zarter Sorge zu umgeben, in ihrer gefährlichen Laufbahn ritterlich über sie zu wachen! Ja – er würde kommen – sicher, sicher!
Die matte, trübe Zeit war zu Ende! Er würde kommen!!
*
Zuerst hörte sie bei Wutrows von ihm reden.
»Ich bin heute dem Maler begegnet, der der Daniel nachgereist ist«, sagte Eugenie, während Agathe ihr half, die Brautwäsche mit blauen Bändern zu umknüpfen, denn die Hochzeit sollte nun bald sein. »Hertha Henning zeigte ihn mir. Sie will bei ihm Unterricht nehmen. Ihre Mutter ist froh, dass sie sie nun nicht nach Berlin zu schicken braucht – wenn sie miteinander hungern, kostet’s doch weniger. Ich finde es ziemlich unpassend – er ist noch ganz jung – höchstens achtundzwanzig – na – und der hat schon manches hinter sich.«
»Wieso meinst Du?« fragte Agathe beklommen.
»Ach, das sieht man doch. Aber was ist Dir denn? Mädchen – Du bist ganz blass! Kennst Du denn Herrn von Lutz?«
»Ich war mit Woszenskis in seinem Atelier«, stieß Agathe in ihrer Fassungslosigkeit hervor.
»So – warum hast Du mir davon gar nichts gesagt? Aber so setze Dich doch – Du wirst wahrhaftig ohnmächtig! Nein – dies Mädchen! – Er sieht sehr gut aus – so ein weltmännischer Chic, den die Herren hier bei uns immer nur imitieren. Komm – trink ein Glas Wein!«
Hertha Henning hatte also Unterricht bei ihm … Nein – eifersüchtig konnte Agathe auf Hertha nicht werden – dazu war deren Nase zu lang und zu spitz.
Sie versuchte, einen Stuhl zu zeichnen – eine Blume – es missglückte vollständig. Sie hatte gar kein Talent – keinen Funken. War das nicht jammervoll? Zu nichts hatte sie Anlagen – konnte nicht den kleinsten Vers zu stande bringen. Sie war im Grunde doch ein ganz gewöhnliches Geschöpf.
Und Lutz erkannte sie auch nicht wieder … Als er im Wandelgang des Theaters auf sie traf, sah er sie flüchtig an und grüßte nicht.
XII.
Eugenies und Walters Hochzeit wurde ein großes Fest, mit Polterabendaufführungen und all der sinnigen Unruhe, die der Deutsche bei einem solchen Ereignis gerne erregt. Man schwelgte in Familiengefühl – die entferntesten Onkels, die bejahrtesten Tanten wurden eingeladen, waren sehr gerührt bei der Trauung und wärmten nachher in den Ecken mit spitzen Bemerkungen alte Familienzwistigkeiten wieder auf.
Agathe musste unter ihrem rosaseidenen Kleide die ganze stumme, hoffnungslose Qual verbergen, die ihr Herz seit Monaten folterte. Wie leicht wäre es Eugenie gewesen, die Bekanntschaft von Herrn von Lutz zu machen und ihm eine Einladung zum Polterabend zu verschaffen. Das wäre dann ein Fest für sie geworden … Es war so unrecht von Eugenie – freilich – die dachte immer nur an sich.
Sie würgte fortwährend an ihren Tränen, aber bei einer Hochzeit fiel das nicht weiter auf. Martin Greffinger war ihr Brautführer. Er hatte sich sehr verändert, seit sie ihn zuletzt gesehen. Nachdem er das juristische Studium aufgegeben hatte, war er ein halbes Jahr in England gewesen. Was er dort getrieben, wusste niemand. Um Lord Byrons Willen war er gewiss nicht hingereist. Die höhnische Falte um seinen Mund hatte sich noch vertieft. Schweifte sein Blick feindlich über die Hochzeitsgesellschaft, so richtete er ihn gleich wieder vor sich nieder – in eine Welt, die nur er selbst zu sehen schien.
Trotz Agathes Aufforderung erzählte er nichts von seiner Reise; was er drüben getan und erlebt habe, interessiere sie ja doch nicht, sagte er. Auch versuchte er keine jener Neckereien, mit denen er sie sonst oft grausam zu quälen pflegte – bemühte sich sogar, freundlich gegen sie zu sein. Aber die Versuche versanken immer wieder in einer großen Gleichgültigkeit, die seine Haltung, jede seiner Bewegungen und vor allem seine Stimme beherrschte. So schleppte sich das Gespräch trübe und gezwungen, durch Pausen völligen Schweigens unterbrochen, während des langen Diners hin. Wie fremd sie sich geworden waren, die sich doch einst so lieb gehabt!
Alles ging während des ganzen Festtages glatt und gut von statten. Nur einmal hörte die Tischgesellschaft Frau Wutrow von der Küche her mit dem Lohndiener wegen des großen Weinverbrauchs zanken. Ihr Gesicht trug, als sie wieder hereinkam, vor Ärger fast die Farbe ihres rot und blau changierenden Seidenkleides. Aber, wie gesagt, mit Ausnahme dieses kleinen Zwischenfalls war es eine ideale Hochzeit.
Die grüne Myrtenkrone saß Eugenie tadellos auf dem blonden Kopf, der Brautschleier fiel wohl zwei und einen halben Meter lang über die königliche Schleppe; Bei der Trauung hatte er auch ihr Antlitz verhüllt – das fand man so poetisch!
Sie war fast die Munterste unter ihren Gästen. Walter dagegen schien bewegt und still.
Nach dem Diner nahm Eugenie ihren Kranz vom Haupt und setzte ihn Onkel Gustav auf. Die meisten fanden diesen Scherz sehr anstößig. Mit einem Myrtenkranze spaßt man nicht. Der dicke rosenrote Onkel sah außerordentlich komisch in dem unerwarteten Schmucke aus. Es war das einzige Mal, dass Greffinger in ein lautes Lachen verfiel. Eugenie blickte aus ihren Schleierfalten wie aus leichtem Gewölk zu ihm hinüber. Mit der rauschenden milchweißen Schleppe, das Champagnerglas in der Hand, ging sie um den Tisch und stieß mit ihm an. Ihre Lider waren gesenkt, und die goldigen Wimpern zitterten ein wenig, wie die eines Kindes, das um Verzeihung bitten möchte. Sie hob sie zögernd, in ihren Augen lag eine sanfte Bitte. Agathe hörte, wie sie leise zu ihm sprach: »Auf gute Freundschaft!« Er machte ihr eine tiefe steife Verbeugung.
Agathe begleitete sie hinaus, ihr beim Umkleiden zu helfen, sie war aufgeregter als die kühle Braut, welche umsichtig die letzten Anordnungen für die Reise traf.
Nachdem das junge Paar abgefahren war, zog sich Agathe in Eugenies Schlafzimmer zurück und blieb dort mit dem ausgedienten Hochzeitsstaat, der auf den Stühlen umherlag, allein. Sie schluchzte recht von Herzen. Endlich trocknete sie ihre Augen, wusch sich das Gesicht und ging wieder in die untere Etage hinab.
Die Gesellschaft hatte sich zerstreut, die Fremderen waren verschwunden. Im Salon fand Agathe ihre Eltern und den alten Wutrow müde und einsilbig zwischen einem großen Kreise von Verwandten sitzen. Frau Wutrow teilte unter ihre Leute Kuchen aus und begann das Silber fortzuschließen. In dem Erker des Esssaales hatten sich Cousine Mimi von Bär mit ihrem Bruder, Lisbeth Wendhagen, die dritte Brautjungfer, Onkel Gustav und der Prokurist des Geschäftes um einen Rest Bowle versammelt. Jenseits des langen Korridors, nach dem Garten hinaus lag Eugenies Boudoir. Sie hatte, als sie in den Wagen stieg, Agathe gebeten, dort ihren Schreibtisch zuzuschließen und den Schlüssel in Verwahrung zu nehmen. »Mama kramt sonst in allen Schubladen herum – Du bist diskreter, das weiß ich.«
Müden, leisen Schrittes ging Agathe, ihr Versprechen zu erfüllen. Sie hob den Vorhang. Da stand Greffinger, dem Eingang den Rücken wendend, neben dem kleinen Sofa, wo er oft mit den beiden Mädchen gesessen und vergnügten Unsinn geschwatzt – er hatte den Kopf in die wollene Fenstergardine gewühlt – seine breiten Schultern zuckten, Agathe hörte sein stoßweises röchelndes Weinen. Bestürzt stand sie vor diesem Schmerz – zum ersten Mal sah sie die Leidenschaft, die ihre eigene Gesundheit still und rastlos untergrub, bei einem kräftigen Manne ausbrechen. Sie machte eine Bewegung – sie hätte ihn gern in den Arm genommen und mit ihm geweint, ihn gestreichelt und getröstet. In ihrer Schwäche fühlte sie sich jetzt stärker als er – ein solches Elend passte besser zu ihr, als zu dem derben Greffinger.
Aber sie wagte nicht, ihrem Wunsche nachzugeben und schlich vorsichtig zurück. Er hatte sie nicht bemerkt.
*
Nach der Hochzeitsreise zogen die jungen Heidlings in die obere Etage des Wutrow’schen Hauses, die für sie mit modernen Tapeten, altdeutschen Öfen und Parquetfußböden neu hergerichtet worden war.
Eugenie spielte nun ein reizendes Hausmütterchen. Walters Kameraden feierten sie als das Muster der deutschen Offiziersfrau. Es bildete sich ein Sport bei den jungen Herren aus: Heidling zum Dienst abzuholen, nur um in der frühen Morgenstunde Eugenie in den neuen Negligés und dem koketten Spitzenhäubchen an der Kaffeemaschine zu sehen und eine von ihren geschickten Händen schnell bereitete Tasse Mokka im Stehen herunterzustürzen.
Abends konnte man regelmäßig ein bis zwei Lieutenants, auch wohl einen unverheirateten Hauptmann bei Heidlings finden.
Der fröhliche Jugendverkehr zog nach Walters Heirat ganz natürlich zu den jungen Leuten hinüber. Man bekam hier ein eben so gutes Abendessen und durfte sich doch ungenierter gehen lassen, als unter den Augen des Regierungsrates.
Agathe war zwar von Eugenie ein für allemal eingeladen, aber sie mochte die Eltern nicht viel allein lassen. Papa hatte es gern, wenn sie vorlas. Manchmal freilich war er auch zum Hören zu angegriffen und saß schweigsam, verstimmt mit seiner Zigarre in der Sofaecke. Oder er musste auch noch arbeiten und liebte es dann, von seinen Akten aufblickend, durch die geöffnete Tür ihren braunen lockigen Kopf unter dem Lampenlicht zu sehen, wie sie der Mama half Wäsche stopfen. Das waren eintönige Abende. Agathe konnte die Einsamkeit, in der sie früher endlosen, glücklichen Träumereien nachhing, nicht mehr gut ertragen.
Die Eltern hatten mit Wutrows und den jungen Leuten zusammen im Theater abonniert. Das Billet kam nur selten an Agathe – es war jedes Mal ein aufregendes Ereignis. Früher hatte sie nur Sinn und Begeisterung für Tragödien gezeigt – das hatte sich nun geändert. In den großen Dramen gab es selten Rollen für die Naive. Und nur wenn die Daniel auftrat, war Agathe sicher, Lutz im Theater zu finden.
Eugenie wusste das freilich ganz genau, aber sie und ihr Mann zogen auch Lustspiele und Possen vor, und bitten konnte Agathe nicht um ein Billet – nein – es war furchtbar, wie sie sich schämte und fürchtete, um dieser unglückseligen Liebe willen.
Lutz stand meist im Hintergrunde der Proszeniumsloge. Agathe konnte seinen Kopf nur sehen, sobald er sich vorbeugte. Auf diese flüchtigen Sekunden wartete sie mit einer bebenden Gespanntheit.
Unbegreiflich blieb es ihr, wo Fräulein Daniel bei ihrer fragwürdigen Erziehung diese leichte und anmutige Vornehmheit des Wesens hatte erwerben können. Die anderen Bühnendamen erschienen neben ihr plump und roh. Selbst eine gewisse Affektation verzieh man ihr, sie kleidete sich gut. War ihr Näschen, ihr ausdrucksvoller Mund ganz geistreiche Schelmerei – die Augen blieben immer ernst, sie konnten gemütvoll und traurig blicken. Agathe begriff es nicht, warum Lutz oft nur zu einer Szene kam und bald wieder verschwand. Nein – er liebte die Daniel nicht … Applaudierte er auf eine nachlässige, diskrete Weise, so tauchten seine schmalen, weißen, unruhigen Hände gleichsam körperlos aus dem Dunkel der Loge hervor.
Dann hörte Agathe Bemerkungen unter ihren Nachbarn über seine Beziehungen zur Daniel.
»… Er soll ihr schon seit Jahren den Hof machen, aber sie weist ihn konsequent ab.«
»– So – so – da werden doch auch andere Dinge geredet. Eine Zeit lang war sie ganz auffällig von der Bühne verschwunden – es ist übrigens schon lange her.«
»Ja – damals hatte sie ein Halsleiden.«
»Ach – die Halsleiden der Schauspielerinnen …«
»Im übrigen hat er im letzten Sommer der Professor Wallis in Norderney rasend die Cour gemacht …«
»Lieber Gott, was will denn das besagen?«
Solche Redensarten bereiteten Agathe ein unerträgliches Weh. Wie konnten die Leute nur über ihn reden wie über einen beliebigen jungen Mann?
*
Inzwischen wurde die Begegnung mit ihm, die das Mädchen sich zu jeder Stunde fieberhaft wünschte, Eugenie zu teil. Sie erzählte ihrer Schwägerin davon, ein spöttisches Lächeln huschte um ihren Mund.
»Ich habe heute Deinen Lutz gesprochen.«
»Du –? Wo?« fragte Agathe atemlos.
»Höchst komisch war’s. Ich hole mir bei dem Musikschmidt neue Noten … Außerdem habe ich noch zwei Pakete, Muff – Schirm. Dazu mein Kleid aufzunehmen. Ich versuchte, das alles mit meinen zwei einzigen Händen festzuhalten. Wer kommt, als ich die Stufen runtersteige? Lutz! – bemerkt meine Bemühungen – lächelt. Er hat übrigens ein entzückendes Lächeln. Und denke Dir – ich Gans! Lasse meine Notenblätter unter dem Arm hervorrutschen – ihm gerade zu Füßen – alle auseinander geflattert. Er bückte sich natürlich und wir haben sie dann ganz artig vom Schnee wieder aufgesucht. – Ich dankte ihm für seine Mühe und er antwortete: ›O – bitte sehr!‹ – Wenn er dieses bitte sehr zu Dir gesagt hätte – was Agathe?«
Sie brach in Tränen aus.
»Mein Gott – geht’s Dir denn so tief?« rief Eugenie erschrocken.
»– Ich habe ihn mir um Deinetwillen ziemlich genau angesehen«, begann sie verständig. »Es ist einer von den Gefährlichen – das ist keine Frage. Aber Kind – glaubst Du denn, dass Du auch nur einen Gedanken mit dem Manne gemein hast?«
»Ich hab’ ihn lieb«, murmelte Agathe leise. Eugenie seufzte. Sie schnippte zierlich mit den Fingern ein Brosämlein von ihrer neuen Tischdecke und ihre Bewegung deutete an, sie lege nicht viel mehr Wert auf das Gefühl, von dem Agathe bewegt wurde, als auf diesen spärlichen Überrest eines genossenen und abgetragenen Mahles.