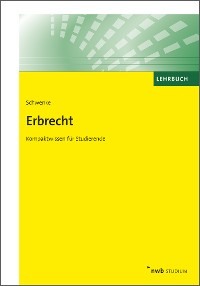Buch lesen: "Erbrecht"
| © | NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne |
| Alle Rechte vorbehalten. | |
| Dieses Buch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahmen der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages unzulässig. | |
| ISBN: 978-3-482-00391-2 | |
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Einführungswerk in das Erbrecht habe ich als Lern- und Arbeitsbuch für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und an Berufsakademien geschrieben, die im Laufe ihres Studiums über den Lehrstoff des Wirtschaftsprivatrechts (d. h. Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht) sowie des Arbeitsrechts hinaus Veranstaltungen zum Erbrecht besuchen, sei es etwa als angehende Steuerberater, Privatkundenberater in Banken oder Testamentsvollstrecker. Das Buch eignet sich aber auch als Einstieg in das Erbrecht für Studierende der Rechtswissenschaften.
Das Erbrecht ist von erheblicher praktischer Bedeutung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Zahl der Erbfälle in der Bundesrepublik Deutschland jährlich bei ca. 900.000 liegt und die Bundesländer im vergangenen Jahr mehr als 7 Milliarden Euro an Erbschaftsteuer vereinnahmt haben.
In knapper und verständlicher Form werden ausgesuchte, wesentliche Bereiche des Erbrechts vermittelt. Aufgrund der weitreichenden Bedeutung, welche die Verordnung (EU) Nr. 650/2012 als sog. Europäische Erbrechtsverordnung (EuErbVO), insbesondere für grenzüberschreitende Erbfälle ab dem 17. 8. 2015 hat, wird diese sowie das Europäische Nachlasszeugnis kurz vorgestellt. Zahlreiche Beispiele und einfache Graphiken dienen der Veranschaulichung. Die Besonderheit des Werks liegt darin, dass es jedem Kapitel Lernziele voranstellt, deren Erreichen mithilfe von Multiple-Choice-Fällen am Ende eines jeden Kapitels selbständig getestet werden kann. Von drei vorgegebenen Antwortvarianten ist jeweils nur eine zutreffend. Die richtigen Antworten finden sich im Schlusskapitel, in welchem sie ausführlich begründet werden. Mit der Lernzielkontrolle soll ein grundlegendes Verständnis für erbrechtliche Zusammenhänge einhergehen.
In das Buch habe ich meine Lehrerfahrung an zahlreichen Hochschulen (Fernuniversität Hagen, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Sciences Po in Frankreich) sowie meine langjährige Praxiserfahrung als Fachanwältin für Erbrecht einfließen lassen.
Mein aufrichtiger Dank gilt meinem Kanzleikollegen Wolfgang Häberle, der als Erbrechtsexperte in zahllosen Diskussionen seinen tiefen Erfahrungsschatz mit mir geteilt hat.
Über Anregungen und Kritik, die der Verbesserung des Buches dienen, natürlich auch über Zustimmung freue ich mich unter: schwenke@dhbw-ravensburg.de.
Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Freude mit diesem Einstiegswerk in das Erbrecht!
Friedrichshafen, im Februar 2017Frederike Schwenke
Für Andreas
A. Einführung
Das deutsche Erbrecht zeichnet sich dadurch aus, dass das gesamte Vermögen des Erblassers mit seinem Tod automatisch auf den oder die Erben übergeht (§ 1922 Abs. 1 BGB). Der Übergang des Vermögens als Ganzes, also des positiven und des negativen Vermögens, auf den oder die Erben wird als Universalsukzession oder als Gesamtrechtsnachfolge bezeichnet. Der Eintritt in die gesamten vermögensrechtlichen Positionen des Erblassers bedeutet, dass der oder die Erben etwa Eigentümer beweglicher und unbeweglicher Sachen, Inhaber schuldrechtlicher Forderungen etc. werden. Mehrere Erben bilden eine Gesamthandsgemeinschaft, sog. Erbengemeinschaft. Diese hat keine eigene Rechtspersönlichkeit1).
Eine Nachfolge in einzelne Vermögensrechte des Erblassers ist nicht möglich. Das Vermächtnis, durch das der Erblasser einen einzelnen Vermögensgegenstand einer bestimmten Person zuwenden kann, führt nicht zu einem automatischen Eintritt in die Rechtsposition des Erblassers, sondern begründet nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den oder die Erben (§ 2174 BGB).
Ausnahmsweise kommt es aber nicht zur Gesamtrechtsnachfolge, wenn es um Anteile an einer Personengesellschaft geht. Hier kommt es zu einer Sondererbfolge. Auch bei Erbhöfen nach der Höfeordnung wird der Hof unabhängig vom sonstigen Vermögen an einen Hoferben vererbt.
Der Übergang des Vermögens des Erblassers erfolgt automatisch sofort mit dem Erbfall, ohne Zutun des Erben von selbst (sog. Vonselbsterwerb)2). Ob der Erbe Kenntnis von dem Erbfall hat oder sogar gegen seinen Willen3) Erbe wird, ist unerheblich. So bedarf es für die Universalsukzession keiner Annahmehandlung des Erben oder eines behördlichen oder gerichtlichen Aktes. Dem Erbe obliegt die Berichtigung der Nachlassverbindlichkeiten (§ 2046 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ihm bleibt es aber unbenommen, sich durch Ausschlagung der angefallenen Erbschaft wieder zu entledigen.
B. Gesetzliche Erbfolge
Lernziele
Nachdem Sie dieses Kapitel bearbeitet haben,
 | können Sie im Rahmen des Verwandtenerbrechts den/die gesetzlichen Erben mit der/den entsprechenden Erbquote/n angeben; | |||
 | haben Sie die Grundzüge des Ehegattenerbrechts verstanden; | |||
 | können Sie die Erbquote des Ehegatten und des/der Verwandten bestimmen. | |||
I. Einführung
Hat der Erblasser eine Verfügung von Todes wegen errichtet und bestimmt, wer ihn beerben soll, spricht man von gewillkürter Erbfolge. Die gewillkürte Erbfolge hat Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge.
Die gesetzliche Erbfolge greift dann ein, wenn der Erblasser nicht bestimmt hat, wer Erbe sein soll. Dies kann daran liegen, dass der Erblasser keine oder keine wirksame letztwillige Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) errichtet hat.
Die gesetzliche Erbfolge führt zu einem Familienerbrecht. Zu den gesetzlichen Erben zählen die Verwandten des Erblassers sowie sein Ehegatte oder sein eingetragener Lebenspartner. Mit dem Familienerbrecht wird der besonderen Bedeutung der Familie Rechnung getragen. Die Eltern und andere Verwandte einerseits sowie der Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner des Erblassers andererseits haben in der Regel zum Erwerb des Vermögens des Erblassers beigetragen. Sie sollen daher am Nachlass beteiligt werden, ebenso wie die Kinder und andere Abkömmlinge des Erblassers. Hintergrund der Berücksichtigung der Abkömmlinge ist vor allem der Versorgungsgedanke. Der Gedanke der Versorgung der Abkömmlinge und des Ehegatten liegt auch dem Pflichtteilsrecht zugrunde.
Durch Heirat entsteht keine Verwandtschaft zum Erblasser, so dass es ein gesondertes Ehegattenerbrecht gibt. Es ist mithin zwischen dem Verwandten- und dem Ehegattenerbrecht zu unterscheiden.

Hat der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes keine Verwandten, keinen Ehegatten und auch keinen eingetragenen Lebenspartner, oder haben alle vom Nachlassgericht ermittelten Erben die Erbschaft ausgeschlagen, so ist das Bundesland gesetzlicher Erbe, in dem der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte (§ 1936 BGB, sog. gesetzliches Noterbrecht des Staates).
Beispiel: Die verwitwete Erblasserin hat zwei Kinder und eine Schwester. In einem wirksamen Testament hat die Erblasserin bestimmt, dass sowohl ihre Schwester als auch ihre Freundin als Vermächtnis je ein Grundstück erhalten. Der Nachlass setzt sich im Wesentlichen aus diesen beiden Grundstücken zusammen. Alle vom Nachlassgericht ermittelten Abkömmlinge der Erblasserin haben – wie die Schwester der Erblasserin auch – die Erbschaft ausgeschlagen, so dass das Bundesland, in welchem die Erblasserin zuletzt wohnhaft war, Erbe ist. Dieses hat die Pflichtteilsansprüche der beiden Kinder und etwaig verbleibende Vermächtnisansprüche der Vermächtnisnehmer aus dem Nachlass zu befriedigen.
II. Das gesetzliche Verwandtenerbrecht
Das gesetzliche Verwandtenerbecht setzt die Verwandtschaft voraus. Wer verwandt ist oder einem Verwandten gleichgestellt wird (Adoption), bestimmt sich nach dem Familienrecht, insbesondere nach § 1589 Abs. 1 BGB.
Ausgangspunkt der weiteren Ausführungen ist, dass der Erblasser nicht verheiratet ist und auch keinen eingetragenen Lebenspartner hat.
1. Parentel- oder Ordnungssystem
Bei der Beantwortung der Frage, welche Verwandten des Erblassers gesetzliche Erben sind, ist auf das Parentel-1) oder Ordnungssystem abzustellen. Danach werden die Verwandten je nach Abstammung in Ordnungen unterteilt.
Folgende Ordnungen sind zu unterscheiden:
| Erben 1. Ordnung: | Abkömmlinge des Erblassers, § 1924 Abs. 1 BGB (Kinder des Erblassers und deren Abkömmlinge, also Enkel und Urenkel etc.) | |||
| Erben 2. Ordnung: | Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, § 1925 Abs. 1 BGB (Eltern des Erblassers, dessen Geschwister, Neffen und Nichten etc.) | |||
| Erben 3. Ordnung: | Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, § 1926 Abs. 1 BGB (Großeltern des Erblassers, dessen Onkel und Tanten, Cousins/Vettern und Cousinen/Basen etc.) | |||
| Erben 4. Ordnung: | Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, § 1928 Abs. 1 BGB | |||
| Erben 5. Ordnung und der ferneren Ordnungen: | Ururgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge bzw. entferntere Voreltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, § 1929 Abs. 1 BGB | |||
Beispiel: Die 90-jährige verwitwete Erblasserin, die keine Kinder hat, wird von ihrer Schwester beerbt sowie von den Kindern ihres vorverstorbenen Bruders (= Nichten und Neffen) als den Erben der 2. Ordnung.
Verwandte einer niedrigeren Ordnung verdrängen Verwandte einer höheren Ordnung bei der Frage, wer den Erblasser beerbt (§ 1930 BGB).
Beispiel: Die Eltern des Erblassers, seine Geschwister und Nichten und Neffen (= Erben 2. Ordnung) sind nicht erbberechtigt, wenn nur ein Enkel/Urenkel (= Erbe 1. Ordnung) des Erblassers lebt.
2. Regelungen innerhalb der einzelnen Ordnungen
a) Erbfolge innerhalb der 1. Ordnung: Erbfolge nach Stämmen
Gibt es Abkömmlinge des Erblassers (= Erben der 1. Ordnung), so ist der Grundsatz der Erbfolge nach Stämmen zu beachten. Jedes Kind des Erblassers bildet mit seinen Abkömmlingen einen eigenen Stamm (§ 1924 Abs. 3 BGB). Da Kinder des Erblassers zu gleichen Teilen erben (§ 1924 Abs. 4 BGB), gilt, dass die jeweiligen Stämme zu gleichen Teilen zu Erben berufen sind.
Beispiel: Der Erblasser hat vier Kinder. Damit ist von vier Stämmen auszugehen. Jeder Stamm erbt zu je 1/4.
Sind mehrere Stämme vorhanden, so findet innerhalb eines Stammes das Repräsentationsprinzip Anwendung (§ 1924 Abs. 2 BGB). Danach verdrängt der mit dem Erblasser am nächsten Verwandte eines Stammes die anderen Angehörigen seines Stammes. Er repräsentiert seinen Stamm.
Beispiel: Der Sohn des Erblassers repräsentiert seinen Stamm und verdrängt seine eigenen Kinder (Enkel des Erblassers) von der Erbfolge.
Ist dieser Repräsentant vorverstorben, dann geht sein Erbrecht auf seine eigenen Kinder (= Enkel des Erblassers) über. Das Erbrecht verbleibt dem Stamm und fällt auf die nachfolgende Generation, sog. Eintrittsrecht.
Beispiel: Der Sohn des Erblassers ist bereits vor dem Erblasser verstorben. In diesem Fall treten seine beiden Kinder (= Enkel des Erblassers) an seine Stelle.
b) Erbfolge innerhalb der 2. und 3. Ordnung: Erbfolge nach Linien
Sind nur Erben der 2. und der 3. Ordnung vorhanden, so werden die Erben nach Linien bestimmt.
In der 2. Ordnung bildet jeder Elternteil des Erblassers mit seinen Abkömmlingen eine Linie. Jede Linie erbt zu gleichen Teilen. Auch hier greifen das Repräsentationsprinzip (§ 1925 Abs. 2 BGB) und das Eintrittsrecht (§ 1925 Abs. 3 BGB). Fällt eine Linie aus, so erbt der überlebende Teil alleine (§ 1925 Abs. 3 Satz 2 BGB).
Beispiel 1: Der kinderlose Erblasser wird zu gleichen Teilen von seiner Mutter bzw. der mütterlichen Linie (Abkömmlinge der Mutter = Geschwister bzw. Halbgeschwister des Erblassers) sowie von seinem Vater bzw. der väterlichen Linie (Abkömmlinge des Vaters = Geschwister bzw. Halbgeschwister des Erblassers) mit jeweils 1/2 beerbt.
Beispiel 2: Der kinderlose Erblasser, dessen Vater vorverstorben ist, wird mit 1/2 von seiner Mutter beerbt. Die andere Hälfte des Nachlasses fällt an die Abkömmlinge des Vaters (Geschwister des Erblassers) zu jeweils gleichen Teilen.
Beispiel 3: Der kinderlose 95-jährige Erblasser wird von seinem Bruder mit 1/2 sowie den beiden Kindern seiner vorverstorbenen Schwester (= Nichte/n und/oder Neffe/n) mit je 1/4 beerbt.
Auch in der 3. Ordnung gilt das Linienprinzip. Jeder Großelternteil bildet mit seinen Abkömmlingen eine Linie. Es sind vier Linien zu unterscheiden: zwei mütterlicherseits (Linie des Großvaters mütterlicherseits und Linie der Großmutter mütterlicherseits) und zwei väterlicherseits (Linie des Großvaters väterlicherseits und Linie der Großmutter väterlicherseits). Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen (§ 1926 Abs. 2 BGB). Hier greifen wiederum das Repräsentationsprinzip (§ 1926 Abs. 2 BGB) und das Eintrittsrecht (§ 1926 Abs. 3 BGB). Fällt eine Linie aus, so erbt der überlebende Teil alleine (§ 1926 Abs. 3 Satz 2 BGB). Lebt zur Zeit des Erbfalls nur noch ein Großelternpaar und hat das verstorbene Großelternpaar keine Abkömmlinge, so erben die anderen Großeltern oder ihre Abkömmlinge (§ 1926 Abs. 4 BGB).
Beispiel: Der Erblasser hinterlässt keine Kinder. Zum Zeitpunkt seines Todes lebt noch sein Großvater und dessen Tochter (= Tante des Erblassers). Das andere Großelternpaar ist ohne noch lebende Abkömmlinge vorverstorben. Hier wird der Erblasser von seinem Großvater mit 1/2 und dessen Tochter mit 1/2 beerbt.
c) Erbfolge in der 4. Ordnung: Grad- oder Gradualsystem
In der 4. Ordnung greift statt der Erbfolge nach Stämmen oder Linien das Gradsystem (§§ 1928 Abs. 3, 1929 BGB). Danach ist der gradmäßig nähere Verwandte zum Erben berufen. Die Verwandtschaft ist dem Familienrecht zu entnehmen. Der Grad der Verwandtschaft wird durch die Zahl der sie vermittelnden Geburten bestimmt (§ 1589 Satz 3 BGB).
3. Erbrecht des Adoptierten
Bei dem gesetzlichen Erbrecht des vom Erblasser adoptierten Kindes ist zwischen der Adoption Minderjähriger und der Adoption Volljähriger zu unterscheiden.
Im Fall der Minderjährigenadoption hat das angenommene Kind ein gesetzliches Erbrecht sowohl gegenüber dem annehmenden Elternteil als auch dessen Verwandten, sog. Volladoption (oder Adoption mit starken Wirkungen).
Beispiel: Im Fall des Vorversterbens der annehmenden Mutter tritt der Adoptierte ebenso wie ein leibliches Kind ein und beerbt die Großmutter.
Die Verwandtschaftsverhältnisse des Adoptivkindes zu seiner Ursprungsfamilie erlöschen allerdings (§ 1755 BGB), so dass das Adoptivkind insofern kein gesetzliches Erbrecht hat2).
Bei der Volljährigenadoption hat das adoptierte Kind ein gesetzliches Erbrecht nur gegenüber dem Annehmenden, nicht gegenüber den Verwandten des Annehmenden (§ 1770 Abs. 1 BGB).
Beispiel: Der Angenommene beerbt seine Adoptivmutter. Da keine Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem Angenommenen und den Geschwistern der Annehmenden entstehen, beerbt er diese nicht.
Das angenommene Kind bleibt allerdings gegenüber seinen natürlichen Verwandten erbberechtigt (§ 1770 Abs. 2 BGB)3).
III. Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten bzw. des eingetragenen Lebenspartners
Das gesetzliche Erbrecht der Verwandten wird beschränkt durch das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten des Erblassers bzw. eingetragenen Lebenspartners (Die Aufführungen zum gesetzlichen Erbrecht der Ehegatten können auf das gesetzliche Erbrecht des eingetragenen Lebenspartners übertragen werden). Mit anderen Worten: Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten geht dem gesetzlichen Erbrecht der Verwandten vor. Erst wenn das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten bestimmt ist, kann in einem zweiten Schritt das Erbrecht der Verwandten des Erblassers ermittelt werden. Den Verwandten fällt das zu, was kraft Gesetzes nicht an den Ehegatten geht. Hintergrund des Ehegattenerbrechts ist die Existenzsicherung des überlebenden Ehegatten, welche sich an den bisherigen Lebensumständen orientiert.
1. Voraussetzungen des gesetzlichen Erbrechts des Ehegatten
Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten setzt voraus, dass
 | die Ehe wirksam geschlossen wurde; | |||
 | die Ehe durch den Tod eines Ehegatten beendet wurde; | |||
 | das Ehegattenerbrecht nicht ausgeschlossen ist (§ 1933 BGB)4); | |||
 | dass auf das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht nicht verzichtet wurde (§ 2346 Abs. 1 BGB); | |||
 | dass keine Erbunwürdigkeit vorliegt i. S. des § 2339 BGB. | |||
Für die Berechnung des Erbteils des Ehegatten ist darüber hinaus zu bestimmen,
 | welcher Ordnung die neben dem Ehegatten miterbenden Verwandten angehören (§ 1931 Abs. 1 BGB). | |||
 | in welchem Güterstand5) die Eheleute zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers gelebt haben (§ 1931 Abs. 3 und Abs. 4 BGB). | |||
a) Zugewinngemeinschaft
Haben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt, kann sich der Erbteil des Ehegatten gemäß §§ 1931 Abs. 3, 1371 Abs. 1 BGB pauschal um 1/4 erhöhen.
Der Ehegatte erhält damit folgenden Erbteil:
 | neben Erben der 1. Ordnung 1/2 (1/4 + 1/4); | |||
 | neben Erben der 2. Ordnung 3/4 (1/2 + 1/4); | |||
 | neben Erben der 3. Ordnung | |||
| sofern alle Großeltern leben 3/4 (1/2 + 1/4)sofern keine Großeltern leben 1/16)sofern einzelne Großeltern und Abkömmlinge von Großeltern leben 3/4 + 1/8 = 7/8. | ||||
Beispiel: Der Erblasser lebte mit seiner Ehefrau im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Er hatte keine Kinder. Neben der Ehefrau des Erblassers leben zum Zeitpunkt seines Todes noch sein Großvater und dessen Sohn (= Onkel des Erblassers).
Die gesetzliche Erbfolge stellt sich wie folgt dar: Die Ehefrau erbt als gesetzliche Erbin neben Großeltern (Erben 3. Ordnung) gemäß § 1931 Abs. 1 Satz 1 BGB 1/2. In Fällen in denen der Güterstand durch den Tod des Ehegatten beendet wird, erhöht sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten pauschal gemäß §§ 1931 Abs. 3, 1371 Abs. 1 BGB um 1/4, und zwar unabhängig davon, ob überhaupt ein Zugewinn erzielt wurde. An sich würde das verbleibende Viertel unter dem Großvater und seinem Abkömmling als den Erben der 3. Ordnung aufgeteilt, § 1926 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 BGB. Der Großvater und der Onkel des Erblassers würden jeder 1/8 erhalten. Es ist allerdings § 1931 Abs. 1 Satz 2 BGB zu beachten. Danach erhält der Ehegatte den Anteil, der nach § 1926 dem Abkömmling des einen Großelternteils zufallen würde. Danach stellt sich die Erbfolge wie folgt dar: Die Ehefrau erhält zu ihrem 3/4-Anteil noch 1/8, d. h. sie beerbt den Erblasser mit einem Anteil von 7/8, während der Großvater 1/8 erbt.7)
Zu dem dargestellten erbrechtlichen pauschalen Zugewinnausgleich kommt es nur, wenn der überlebende Ehegatte Erbe oder Vermächtnisnehmer geworden ist (§ 1371 Abs. 2 BGB).
Denkbar ist aber auch, dass der Ehegatte weder Erbe noch Vermächtnisnehmer wird. Dies kann sich aus einer entsprechenden Verfügung von Todes wegen des Erblassers aber auch aus einer Ausschlagung der Erbschaft durch den überlebenden Ehegatten ergeben (sog. taktische Ausschlagung). Auch in den Fällen, in denen der Ehegatte ausschlägt, stehen ihm der konkret zu berechnende güterrechtliche Zugewinnausgleich und der sog. kleine Pflichtteil zu (§ 1371 Abs. 3 BGB). Der sog. kleine Pflichtteil beträgt neben den Kindern des Erblassers 1/8, neben den Eltern des Erblassers 1/4 aus dem um die Zugewinnforderung bereinigten Nachlass.
Da es sich bei der Zugewinnforderung um eine Nachlassverbindlichkeit handelt, ist diese vorweg vom Nachlass in Abzug zu bringen. Dem nicht enterbten Ehegatten steht also ein Wahlrecht zu: Entweder der Ehegatte entscheidet sich für die erbrechtliche oder die güterrechtliche Lösung, wobei er bei letzterer den kleinen Pflichtteil erhält.
Beispiel: Eric Fröhlich (E) ist mit Eva Fröhlich (EF) im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet. Die Eheleute haben drei gemeinsame Kinder: Karl, Kevin und Klaus. Zum Zeitpunkt der Eheschließung verfügte E über kein nennenswertes Vermögen. Das Anfangsvermögen der EF belief sich auf 30.000 € und beträgt zum Zeitpunkt des Todes des E 50.000 €. Während der Ehe erwarb E ein Grundstück mit einem Wert in Höhe von 300.000 €. Sonstiges Vermögen haben die Eheleute nicht erworben.
Die erbrechtliche Situation stellt sich wie folgt dar:
Nach § 1931 Abs. 1 BGB wird EF neben den Abkömmlingen des E als Verwandten der 1. Ordnung Miterbin zu 1/4. Sodann ist der Güterstand festzuhalten. Hier lebten die Eheleute im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Über § 1931 Abs. 3 BGB, der auf § 1371 Abs. 1 BGB verweist, erhöht sich die Erbquote der EF um 1/4 als pauschaler Zugewinnausgleich (sog. erbrechtliche Lösung). Der Erbteil der EF beträgt 1/2 (Wert: 150.000 €)8).
Die übrige Hälfte wird unter den drei Kindern Karl, Kevin und Klaus gleichmäßig verteilt. Jedes Kind erbt demnach 1/6 (300.000 € · 1/6 = 50.000 €).
Schlägt die EF die Erbschaft gemäß § 1371 Abs. 3 BGB aus9), so kommt es zur sog. güterrechtlichen Lösung. Gesetzliche Erben des E sind seine drei Kinder mit einem Erbteil von je 1/3 (§ 1924 Abs. 1 und Abs. 4 BGB).
Zur Bestimmung des Anspruchs der EF ist der güterrechtliche Zugewinnausgleich gemäß § 1371 Abs. 3 BGB vorzunehmen. Dieser stellt sich wie folgt dar:

Darüber hinaus hat EF einen Pflichtteilsanspruch in Höhe der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils (§§ 2303 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 1371 Abs. 3 BGB). Diesen kann sie ausnahmsweise trotz Ausschlagung verlangen. Nach herrschender Meinung ist gesetzlicher Erbteil allein die Quote des § 1931 Abs. 1 BGB, ohne dass die pauschale Erhöhung gemäß § 1371 Abs. 1 BGB berücksichtigt wird (sog. kleiner Pflichtteil)10). Damit kann EF als Pflichtteil 1/8 (1/2 von 1/4) des um den güterrechtlichen Ausgleichsanspruch bereinigten Nachlasses geltend machen:
Die Zugewinnausgleichsforderung ist als Nachlassverbindlichkeit in Form einer Erblasserschuld (§ 1967 Abs. 2 BGB) in Höhe von 140.000 € vom Nachlasswert in Höhe von 300.000 € abzuziehen, bevor die konkrete Pflichtteilsforderung, der erbschaftsteuerpflichtige Erwerb des Erben (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG) oder nachlassabhängige Vermächtnisse (Quotenvermächtnisse) berechnet werden11). Es verbleibt hier ein bereinigter Nachlass in Höhe von 160.000 €. Der Pflichtteilsanspruch der EF beträgt 20.000 € (1/8 von 160.000 €).
Nach der sog. güterrechtlichen Lösung erhält EF einen Zugewinn in Höhe von 140.000 € und einen Pflichtteil in Höhe von 20.000 €, insgesamt einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Erben in Höhe von 160.000 €. Vergleicht man dies mit dem Ergebnis bei Annahme der Erbschaft durch EF, so erhält EF nach der güterrechtlichen Lösung 10.000 € mehr.
Ob der überlebende Ehegatte sich für die Annahme der Erbschaft oder deren Ausschlagung entscheidet, ist von zahlreichen, insbesondere wirtschaftlichen Kriterien abhängig:
 | Die güterrechtliche Lösung ist überhaupt nur in Betracht zu ziehen, wenn der Zugewinn des verstorbenen den des überlebenden Ehegatten übersteigt (§ 1378 Abs. 1 BGB). Die güterrechtliche Lösung des Zugewinnausgleichs gemäß § 1371 Abs. 1 BGB kann für den überlebenden Ehegatten dann von Vorteil sein, wenn der Nachlass einen hohen Zugewinn umfasst. Gleichwohl ist auch bei hohen Zugewinnen die erbrechtliche Lösung meist interessanter, da es hier nur auf die Höhe des Nachlasses ankommt. | |||
 | Im Fall der güterrechtlichen Lösung wird der Ehegatte nicht Mitglied der u. U. konfliktbeladenen Erbengemeinschaft. Ihm stehen stattdessen sofort fällige Zahlungsansprüche gegen die Erben zu. Es muss keine Teilungsreife des Nachlasses abgewartet werden. | |||
 | Die Zugewinnausgleichsforderung geht Vermächtnissen, Auflagen und Pflichtteilsansprüchen im Rang vor (§ 327 Abs. 1 InsO). | |||
 | Die güterrechtliche, rechnerisch genaue Ausgleichsforderung gehört nach § 5 Abs. 2 Alt. 2 ErbStG nicht zum steuerpflichtigen Erwerb im Sinne des Erbschaftsteuerrechts12). | |||