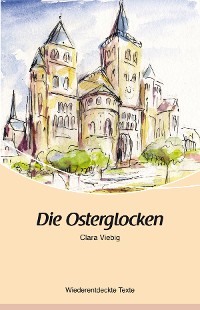Buch lesen: "Die Osterglocken"
© 2020 – e-book-Ausgabe
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Zell/Mosel
Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel
Tel 06542/5151 Fax 06542/61158
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-89801-898-2
Ausstattung: Stefanie Thur
Titel-Aquarell: Heinz M. Müller
Clara Viebig
Die Osterglocken
Wiederentdeckte Texte
Rhein-Mosel-Verlag
Einleitung
Bei meinen Recherchen in alten Zeitungsausgaben bin ich immer wieder auf Texte von Clara Viebig (1860 – 1952) gestoßen, die ich noch an keiner Stelle zuvor gelesen hatte.
So entstand die Idee, diese Lücke zu füllen und ein Buch mit unbekannten Texten zu machen. »Unbekannt« bedeutet hier, dass die Prosatexte in früheren Tagen in verschiedenen Periodika abgedruckt wurden, mittlerweile aber zum Teil in Vergessenheit geraten sind.
Clara Viebig war eine vielseitig interessierte, leistungsorientierte und sehr fleißige Schriftstellerin. Entsprechend umfangreich und kaum überschaubar ist ihr literarisches und nicht-fiktionales Werk. Neben den bekannten Romanen, z. B. »Das Weiberdorf«, »Die goldenen Berge« oder »Die Wacht am Rhein«, hat sie zu ihren Lebzeiten neben Essays und Rezensionen mehr als 100 Kurzprosatexte (Novellen, Erzählungen, Skizzen) in Zeitungen, Illustrierten und Magazinen veröffentlicht.
Ich schätze ihre Kurzprosa, z. B. »Das Heiligenhäuschen«, »Heinrich Feiten« oder »Die Heimat«, hoch ein, und bin der Meinung, dass diese im Großen und Ganzen nicht nur auf dem selben Niveau wie das der Romane anzusiedeln ist, sondern dass Clara Viebig gerade in der Gestaltung der Kurzprosa ganz erstaunliche Leistungen erbracht hat. So sind aus meiner Sicht ihre Novellen, die in der Eifel, an der Mosel oder in Berlin spielen, der bedeutendere und betrachtenswertere Teil des Werkes.
Die in diesem Buch vorliegenden Novelletten, Erzählungen und Betrachtungen erweitern das bisher bekannte Bild der Schriftstellerin Viebig und ihrer Arbeit, da in den Texten interessante neue Facetten ausgebreitet werden. So lernen wir die in Trier geborene Autorin nicht nur als Verfasserin von heimatlich-ländlich geprägten Texten, sondern auch als eine am politischen Tagesgeschäft interessierte und sozial engagierte Zeitgenossin, die u. a. ihrer Empörung über die Besetzung des Ruhrgebiets in literarischer Form Luft macht, als eine begabte Märchenerzählerin und als Verfasserin von zwei Reise-Feuilletons, einer historischen Erzählung und einer Buchbesprechung kennen.
Im Nachwort werde ich auf einzelne Beiträge genauer eingehen.
Manfred Moßmann
Achim, im Januar 2020
Die Osterglocken
Novellette
Leise rührt es an den Glocken. Kein voller eherner Klang, nur ein zartes Tönen – ein Hauch von oben weht über die engen Gassen der alten Stadt.
»Hörste?«, sagte das kleine Mädchen in der Rindertanzstraße und hob den kleinen Finger in die Höhe, »hörste, Sus, de Engelcher läuten!«
»Was – Engelcher?« Die große Schwester schüttelte gleichgültig den Kopf und zerrte die Kleine hinter sich drein. »Sie probieren nur – sieben Uhr – wart’, gleich läuten se Feierabend.« Sie seufzte auf und sah mit den großen umschatteten Augen trübselig vor sich hin. »Wieder ein Tag zu End’, und dann kommt wieder ein Tag und wieder einer – o Jeß! – und noch derzu morgen Ostern, ich wollt’, ich –«
»Still, Sus, hörste?«, flüsterte scheu die Kleine und faßte hastig nach dem Kleide der Großen, »hörste?«
Sie blieben stehen. Vom Dom her kam wieder das seltsame Läuten, oder war’s von der Liebfrauenkirch’? Kein regelrechtes Bimbam, nur ein schüchternes Bi – i – im – jetzt stockte es plötzlich, aus war’s!
»Was der Küster Cleren nur macht?« Susanna Schommer, kurzweg Sus genannt, sah sich verwundert um. »Se läuten ja e so komisch!«
Das Kind an ihrer Hand lachte über das ganze blasse Gesicht und nickte triumphierend. »Siehste, das is net der Herr Cleren, das sind de Engelcher, die sind vom Himmel geflogen un läuten nu de Osterglocken. Komm bei den Herr Lintz in de Fleischstraß’, Sus! Da kannste se kucken mit weiße Röckcher un Kränzcher auf em Kopf, da sind se abgemalt – komm, rasch!«
Kättchen Schommer, die kleine Lahme, zog die große Schwester eilig mit sich fort, sie lief, so flink sie konnte; die kranken Füße taten ihr weh auf dem holprigen Pflaster, aber sie rannte doch. Jetzt waren sie auf dem Domfreihof – im Dom alles still – merkwürdig, alles still! Aber von der Liebfrauenkirche ein volles, stattliches Läuten, ein ganzer Chor von Glocken fällt ein – und jetzt, jetzt – endlich! nun fängt’s auch vom Dom an!
»O weh!« – das Kind schlägt die Hände zusammen – »jetzt läuten de lieben Engelcher nimmeh, nu is es widder der Herr Cleren mit de Jungens! Die Engelcher sind net e so stark, die tun nur ganz leis’ dran tippen – gelt Du, Sus?«
»Bim – bam – bim – bam« – von allen Kirchen der alten Stadt rufen die ehernen Stimmen, von allen Kapellen gesellen sich hellere Stimmlein zu. Das sind mächtige Tonwellen, die ins Land hinaus strömen, mächtige Klänge, die der Welt verkünden: »Wir tönen! Wir läuten! Freut Euch des Festes!«
Da ist niemand in der ganzen Stadt, der das nicht hören könnte; über die grauen Schieferdächer ruft es hin, über die blaue Mosel, über die Berge jenseits mit dem wunderbaren Rot der Felsen und den frühen Blütenbäumen am Fuß, über die Rasenhänge am Wald mit den ersten scheuen Blumen. Und die gelbe Primel, der Himmelsschlüssel, schlägt die Glöckchen aneinander und klingelt mit im großen Chor: »Ich töne! Ich läute! Ich schließe den Himmel auf, den Frühlingshimmel – er ist offen, tretet ein!«
Ostern, Ostern! Sonst läuten die Glocken alle in Moll, heute läuten sie in Dur; wer nur die Modulation recht verstehen kann!
Schommers Sus verstand sie nicht. Sie lehnte mit der kleinen Schwester an dem blanken Messingstabe vor dem Schaufenster der großen Buchhandlung in der Fleischstraße und drängte das Gesicht an die Scheiben. Da waren viel Osterkarten ausgelegt, bescheidenere und reichere, geschmacklose und geschmackvolle; überall Frühlingsblüten, blau, weiß, rote, Ostereier, Osterhasen – aber eine, eine in der Mitte –
»Hah!« Die blassblauen Augen des Kindes wurden dunkelglänzend, es wies kramphaft mit dem Finger hin: »Kuckste, kuckste. Da sind se – o die Engelcher, wie goldig, wie lieb!«
Ja, richtig, zwei Engel in weißen Kleidern mit lächelnden Mienen, Kränze im Haar, läuteten große Glocken, die vom Himmel zur Erde hingen; und in den Glocken stand es mit goldenen Buchstaben – Sus entzifferte sie brennenden Blickes –
Wir künden und wir sagen
Von Auferstehungstagen!
Es läuten mit Frohlocken
Die Engel Osterglocken.
***
Fröhliche Ostern!
»Mir nicht – mir nicht,« murmelte Susanna Schommer und zog fröstelnd ihr ärmliches Tuch um die Schultern. Sie wandte den Blick von dem hell erleuchteten Schaufenster ab – wie trüb und düster die Straße schon! Graue Dämmerung kam niedergeflogen und überwob alles mit spinnwebfarbenem Schleier – die blankgeputzten Scheiben, die frisch aufgesteckten Gardinen, das papierblumengeschmückte Lamm bei Metzger Dietrich, die Fastenbrezeln und die zuckerbestreuten Rodonkuchen beim Bäcker an der Ecke. Die Glocken hallen nicht mehr, mit einem letzten »Bum« sind sie verstummt. Es ist fast finster.
»Komm!«, sagte Susanna Schommer eintönig und beugte sich zu dem Kinde nieder, das müde die lahmen Füße schleppte. – »Leg Deine Ärmcher um meinen Hals, ich tragen Dich!« Und so schritten sie miteinander die bunten Läden entlang, die belebte Straße hinunter, immer weiter, einen langen Weg, bis die Gegend armselig wurde und düster; da wohnten sie. Das schlanke Mädchen hielt den Kopf aufrecht – was war die leichte Last der Schwester? auf dem Herzen lag eine weit schwerere. Die hübschen traurigen Augen blickten gradaus vor sich ins Leere – ach, zwanzig Jahre und kein Lachen mehr, das ist ein Frühling ohne Blumen.
Am Himmel ziehen die Sterne auf, einer nach dem andern, bis sie in Reih und Glied stehen und herunterfunkeln auf die Welt, in der alles Ostern entgegenjauchzt – die Glocken, die Berge, der Strom und der Wald, die schwarze duftende Erde und das Menschenherz. Alle wollen sie Grün, Blumen, Wärme, Licht, Freude – sie strecken die Hände verlangend aus – die Glocken schlagen an – kling klang gloria – Osterglocken.
***
In der schmutzigsten, engsten Gasse, im »Hänneschen sieh dich um« wohnte Schuhmacher Schommer. Er hätte da nicht zu wohnen gebraucht in dem erbärmlichen Hause, er hatte mal einen schönen Laden in der Simeonstraße. Aber wie das so geht, das Moselweinchen schmeckt gut, ’s ist ja auch so billig, und vom billigen Moselweinchen ist es nicht weit zum billigen Schnaps – der Laden schrumpfte immer mehr ein, die Nase blühte immer röter, voller. Über ein paar Jahre hatte man nur noch den ewigen Durst und den guten Humor; die verließen Schommers Pittchen nicht, die waren mit Moselmilch großgezogen. Wenn seine Frau weinte, dann lachte er; wenn sie schalt, lachte er auch, lief nach Dorf Euren auf die Kirmes und schwenkte die hübschesten Mädchen herum; kam er betrunken nach Hause, schlug er nicht – i bewahre – er lachte. Er lachte seine Frau unter die Erde und lachte seiner Sus, der Ältesten, alle Jugend weg.
Sie war vierzehn, als die Mutter starb und das jüngste Kind, das lahme Kättchen, kaum ein paar Wochen alt – nun war sie zwanzig. Sie hatte das Kättchen herumgeschleppt, die drei Brüder geprügelt, den Vater aus dem Wirtshaus geholt, und wenn der draußen in der Sonne lag und faulenzte, saß sie drinnen im Schatten und hämmerte und pochte und steppte und setzte Riester auf – das war ihr Leben. Ein einziges Mal – man soll nicht lügen – ja, da war sie auch lustig gewesen, da hatte sie ein helles Kleid getragen und ein rosenrotes Band um den Hals – sie war jung, sie war hübsch, sie war lebensfroh.
Mit dem Franz Cleren, dem netten Polier, hatte sie zu Euren getanzt – rundirum la la – rundirum la la la – o, war das schön! Hand in Hand waren sie dann nach Hause gegangen, die lange Chaussee unter Obstbäumen zurück. Der Frühling hatte die Bäume mit Blüten überschüttet, die Birnen schneeweiß, die Äpfel rosenrot. Im Straßengraben saß die Grille und zirpte vor Glück; links am Berghange aus lauschigen Büschen klang ein sehnsüchtiges Lied, es war die Nachtigall, sie sang von Liebe; rechts rauschte die Mosel, bald laut, bald leise, sie rauschte ein Schlummerlied. Die Welt war zur Ruh – man hörte nur von Glück und Liebe; Glück sang die Grille, Liebe die Nachtigall. »Ach, wenn wir uns doch kriegten«, pochten zwei Herzen im Takt dazu, zwei selig bange Seufzer folgten wie ein Echo. Es war ja Frühling!
Nun wurde es wieder Frühling, seitdem schon zum dritten Male – der Franz und die Susanna waren noch immer kein Paar; sie war sein Mädchen, er ihr Schatz, und dabei würde es bleiben. Er hatte nichts, sie hatte nichts. Dem Franz sein Onkel, der Küster Cleren im Dome, der hatte wohl was, aber man konnte es ihm doch nicht abverlangen. »Dass de ke Wort sagst«, vermahnte der Franz, und »Jesses, was denkste denn?«, sagte die Susanna. Sie sah den alten Junggesellen nur stumm wehmütig mit den hübschen Augen an; er strich ihr dann die Backen und schenkte dem Kättchen blanke zwei Pfennige. Ach, sie kamen wohl nie zusammen! – – – – –
Mit einem tiefen Seufzer stellte Susanna Schommer die kleine Schwester auf die Schwelle und öffnete die knarrende Haustür im »Hänneschen sieh dich um«. Der Schustertisch war leer, der Vater lag der Länge lang auf dem Rosshaarsofa und ließ die Beine über die Lehne baumeln. Er pfiff sich eins. Jetzt blinzelte er vergnügt.
»No, guden Awend, dir Mädercher! Haste Geld, Sus!«
Zögernd steckte die Tochter die Hand in die Tasche.
»Nor här dermit!«, lachte Schommers Pittchen, sprang wie der Wind vom Sofa auf, entwand ihr die paar Markstücke und kniff sie dann in die Backen. »No, Sus, eweil gehn ich e bische spazieren; gleich bin ich widder zurück!«
»Spazieren?!« Die Tochter lachte bitter. »Du gehst als wieder in’t Wirtshaus, Vatter – morgen ist kein Pfennig mehr da von dem Geld, was ich heut for die besohlten Stiefel gekriegt hab. Denk doch, morgen ist Ostern! Alle Leut feiern, nur wir net – keinen Osterkuchen for uns Kättchen, keine paar Eier for die Jungens! – Vatter« – sie steckte blinzend die Hand aus, ein trostloser Ausdruck lag auf ihrem Gesicht – »Vatter – – !«
»Huit« – er pfiff – »dumm Zeug! Sei net e so uncommod, Sus – immer lustig, dat is hübsch for junge Mädcher, adjö, Kättchen!« Er hob das Kind in die Höhe und küsste es herzhaft ab – »Den Pappa kauft dir ebbes Gudes – en Palzerkuchen on en Zuckerei – gelt Du, e so groß! Adjö, adjö!« Er schwenkte lachend zur Tür, heraus war er – fort – durch den stillen Abend klang sein helles Pfeifen.
»O Jesses – oh – –!« Susanna ließ sich auf den Schemel fallen und hielt die Hände vors Gesicht – die schlanken Finger waren schwarz gefärbt vom Schusterpech – leise kam Kättchen geschlichen und nestelte sich auf ihren Schoß ein. Das klägliche Lämpchen flackerte und beleuchtete matt den blonden Mädchenkopf, der sich tief, tief neigte, die schmächtige Kindergestalt mit dem altklug bleichen Gesicht. Draußen ging der Abendwind.
– – – –
»Sus, Essen! Sus, Hunger! Sus, wat kochste morgen?« Wie die wilde Jagd stürmten die Brüder ins Zimmer, drei halbwüchsige, freche Burschen, denen die Eßlust aus den Augen sah. »Sus« – – der jüngste fasste sie um die Taille und wirbelte sich mit ihr durch die Stube – »Sus, morgen is Ostern, da kriehn mer ebbes Feines! Hei!«
»Nix Feines«, sagte die Schwester hart, »der Vatter is im Wirtshaus. Wir haben kein Ostern!« – – »Kein Ostern« – das sagte sich Susanna die ganze Nacht vor, als sie wachend im Bett lag. Nebenan polterte der Vater – er kam betrunken nach Hause – jetzt schnarchte er. O, die Kammer so dunkel, und im Herzen noch mehr Dunkel! Das war wie ein Grab. Ganz unten eingesargt lagen Jugend, Hoffnung und Lebensfreudigkeit, kein grüner Halm sprosste, kein Blütentrieb – Winterstarre deckte alles zu. Es gab kein Ostern, kein Auferstehen!
Heiße Tränen liefen über Susannas Gesicht, sie dachte an ihren Schatz und rang die Hände. »Wir kommen nie zusammen« – eiliger rannen die Tropfen, sie fielen dem Kättchen auf die Stirn, das an der Seite der Schwester fest schlummerte. Es regte sich im Traum, es seufzte, es warf sich hin und her – jetzt flüsterte es: »Im Dom – sie läuten e so komisch – bimbam – bi – i – im – das tut net den Küster Cleren o ne« – sie kicherte – »das sind die lieben Engelcher – Sus – de Engelcher – im Dom – in Lintzen – bimbam – bi – i – im« – –
»Schlaf doch!«
»Bi – i – – – « das Weitere erstarb in undeutlichem Gemurmel. Endlich schlossen sich auch Susannens Augenlider – sie träumte nicht von Engeln, nicht von Ostern, nicht von ihrem Franz; sie träumte vom alten Küster Cleren mit den weißen Haaren um das freundliche Gesicht. Der saß auf einem Glockenstrang und schaukelte hin und her – die Glocke tönte leise, immer leiser – er schaukelte hoch, immer höher – er flog ordentlich, sie wollte ihn haschen, da lächelte er und winkte mit der Hand – fort war er.
Kling, klang gloria – Osterglocken. – – – Im Stübchen des Küsters Cleren standen die Fenster weit offen. Vom nahen Dom Geläut, ernst, heilig, feierlich; gold’ne Morgensonne flutete herein, laue Frühlingsluft. Sie schmeichelten um die Blumenstöcke am Fensterbrett; sie glitten die sauberen Wände entlang über die frommen Heiligenbilder; sie strichen über das weiße Bett, über das stille Gesicht in den Kissen und die gefalteten Hände.
Küster Cleren, der alte Junggeselle, war tot. Gestern, abends beim Feiertageinläuten, hatte es ihn überkommen – ein- zweimal hatte seine Hand den Strang gerührt, da war er umgefallen; entsetzt standen die Knaben, die läuten halfen, daneben. Man hob ihn auf, man trug ihn nach Hause, man holte Franz Cleren, den einzigen Sohn seines verstorbenen Bruders – der junge Polier kam angstvoll gestürzt – »Ohm, Ohm, was is Ihnen?« Der Sterbende versuchte zu lächeln. »Gib mir deine Hand, Franz,« hatte er geflüstert, – »kriegst alles, Franz, alles – gerichtlich gemacht – heirat das Sus, is brav – lasst mir einen Stein setzen, Glocken darauf – sollen läuten, wenn ich aufersteh’« – – und nun wie ein Hauch – »betet für mich« – und noch leiser »freut Euch« – – – – – – Bimbam – kling klang –
»Wein’ net«, sagte der junge Polier, als er mit seiner Sus am Lager des Toten stand, »wein’ net!« und dabei schoss ihm selbst das Nass in die Augen.
»O mein Jesus!«, flüsterte die Susanna und sank vor dem Bett in die Knie, ihre lebenswarmen Hände streichelten sacht die todeskalten. – »Er hat uns so glücklich gemacht, der gute Mann, er muss nun in die Erd’ und wir – wir – oh, Franz!« Sie fiel dem Liebsten um den Hals mit seligen Tränen.
Wenn doch der alte Cleren gesehen hätte, wie sie einander umfasst hielten und sich in die Augen blickten und sich gar nicht lassen konnten – die Glücklichen! Neben ihnen Tod und Grab, hinter ihnen eine dunkle Winternacht, aber vor ihnen jubelnder Frühlingstag, leuchtende Ostersonne!
Vorm Fenster schwirren Vögel auf, sie wiegen sich trillernd im blauen Äther. Fröhliche Menschen eilen zum Dom, feiertäglich gekleidet, Palmzweige in den Händen. Es liegt ein Festglanz auf allen Gesichtern, ein Freudenschein über Himmel und Erde. Die Sonne lacht, die Lüfte lächeln, das junge Grün schimmert, ein mächtiges Wehen rüttelt die Welt auf. – »Erwacht! Erwacht zur Freude, Ostern – Ostern!«
Die Glocken tönen: »Bimbam – bimbam« -
Es waren doch Engel, die sie geläutet haben, das lahme Kind hatte recht – Engel in Kleidern der Unschuld, Frühlingskränze im Haar –
Kling klang gloria. Osterglocken!
Erklärungen:
Rindertanzstraße = (tatsächlicher) Name einer Straße (zwischen Dom und Porta Nigra) in Trier;
Lintzen = wahrscheinlich ein Druckfehler; es könnte »Linnen« oder »Litzen« heißen.
Textquelle:
Linzer Tages-Post, 5. April 1896, S. 1 und S. 2
Die weibliche Feder

Als ich vor ungefähr dreißig Jahren meine ersten kleinen Arbeiten veröffentlichte, riet mir Paul Lindenberg, der damals Herausgeber einer Korrespondenz für Zeitungen war, statt meines ehrlichen Taufnamens »Clara« mich mit einem einfachen »C.« zu begnügen. Er meinte, Publikum und Redakteure hätten nun einmal ein gewisses Mißtrauen gegen die weibliche Feder, besonders, wenn die Autorin noch unbekannt sei; es wäre vorteilhafter für mich, wenn man hinter dem »C.« einen Carl oder Clemens oder Constantin vermutete. Mir war das sehr gleichgültig, und ich gab meine Zustimmung; der erfahrene Herausgeber mußte es ja am besten wissen, wie man einen neuen Autor fördert. Aber ich habe keinen Augenblick geglaubt, daß diese kleinen rheinischen Erzählungen, die in all ihrer Harmlosigkeit den Stempel, wenn auch nicht der späteren Clara Viebig, so doch den einer Frau als Verfasser trugen, wirklich für Produkte männlicher Erzählungskunst angesehen werden könnten. Dennoch sind damals die ersten Briefe, die mit der Bitte um Beiträge von Redaktionen an mich kamen, unter der Anschrift eines Herrn C. Viebig an mich gelangt. Es muß also nicht so leicht sein, die weibliche Feder als solche zu erkennen – oder es muß viele Männer geben, die, wenn sie die Feder führen, ihre Männlichkeit verleugnen.
Die Bedeutung, die der Frauenroman besaß, und die besondere Würdigung, die er fand, hat es nicht verhindert, daß viele bedeutende schriftstellernde Frauen geglaubt haben, sich den Helm einer männlichen Pseudonymität aufstülpen zu müssen. Das klassischste Beispiel dafür ist im vorigen Jahrhundert eine George Sand. Durch und durch Frau im Leben und im Schreiben – trotz der starken Zigarren, die sie geraucht, und trotz des starken Tobaks, den manche ihrer Romane für die damalige Zeit bedeuteten – hat sie den männlichen Decknamen nicht entbehren zu können geglaubt. Sie hat damit auch in Deutschland Schule gemacht. Daniel Stern allerdings, die Mutter von Cosima Wagner, obgleich in Frankfurt von deutschen Eltern geboren, war als Komtesse d’Agoult mehr Französin als Deutsche, aber Karl Detlef, hinter dessen vielgerühmten Namen sich die Schauspielerin Caroline Bauer verbarg, und Moritz von Reichenbach, hinter dem die Gräfin Bethusy Huc steckte, und noch viele andere große und kleine Geister haben ihre Weiblichkeit so verleugnet. Selbst so viel gelesene und beliebte Schriftstellerinnen wie Eugenie John und Elisabeth Bürstenbinder haben es nicht verschmäht, als E. Marlitt und E. Werner die nicht Wissenden über ihr Geschlecht im Unklaren zu lassen. Haben sie damit wirklich die Weiblichkeit ihrer Feder – eine Weiblichkeit, die trotz aller Talentiertheit, für uns einen leisen Beigeschmack besitzt, der uns jetzt nicht mehr mundet – erfolgreich verleugnen können?
Als die Begründerin des deutschen Frauenromans, Sophie von Laroche, die Großmutter von Clemens Brentano und Bettina von Arnim, ihre »Geschichte des Fräuleins von Sternheim« erscheinen ließ, war das deutsche Lesepublikum für die Werther-Stimmung, die in Liebe, Entsagung und Edelmut sich gar nicht genug tun kann, gerade reif geworden. Der Genius Goethes konnte sie in seinem Werther zu ewigem Gedächtnis einfangen, während die Laroche mit ihrem Roman nur der »weiblichen Feder« das Gepräge gab: ein Gepräge der Sentimentalität, Unwahrhaftigkeit und Übertreibung.
Und so mag es denn wohl gekommen sein, daß viele Schriftstellerinnen, auch solche, die von diesen fälschlich als nur weiblich verschrienen Eigenschaften völlig frei waren, sich aber vor dem Odium, das der weiblichen Feder nun einmal anhaftete, fürchteten und sich durch das männliche Pseudonym zu verbergen wünschten. Sind es aber wirkliche Könnerinnen gewesen, so ist ihren Werken ihre Persönlichkeit so aufgeprägt, daß kein Verständiger einen Zweifel an dem Geschlecht des Autors haben kann. Sind sie aber Stümperinnen, die ihr kümmerliches Bettelsüppchen an dem Feuer, das mehr oder weniger berühmte Vorbilder angezündet haben, kochen, so finden sie auch im Heer der schriftstellernden Männer viele ihresgleichen; der stolze Männername, unter dem ihr Werk erscheint, kann es nicht schmackhafter und wertvoller machen. Ein echtes Weib und eine rechte Könnerin – wie sie auch hieße – wird aber immer ein Werk schaffen, in dem sie sich selbst niemals verleugnet.
Ja, mit der Feder ist es eben ein eigen Ding! Eine Pfauenfeder ist sie leider – ob männlich, ob weiblich – sehr häufig. Und auch nicht jede männliche Feder ist die eines stolzen Schwanes, und nicht jede weibliche Feder die – eines ihm ähnlichen Vogels.
Textquelle:
Linzer Tages-Post, 30. Juli 1932, S. 18
Weitere Textquellen:
Bezirksbote für den politischen Bezirk Bruck an der Leitha von Sonntag, dem 17. Dezember 1933, Titelseite
Kärntner Volkszeitung von Samstag, dem 28. Mai 1932, S. 8
Die Woche, 32. Jahrgang Nr. 48, 29. November 1930, S. 16