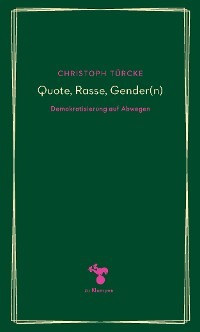Buch lesen: "Quote, Rasse, Gender(n)"
Christoph Türcke
Quote, Rasse, Gender(n)
Demokratisierung auf Abwegen

Eine Vorform des Abschnitts »Quote« erschien unter dem Titel »Lobby- demokratie« in Heft 858 (November 2020) der Zeitschrift Merkur.
© 2021 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
Umschlaggestaltung: Martin Z. Schröder · Berlin
Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt
ISBN Print 978-3-86674-810-1
ISBN E-Book-Pdf 978-3-86674-914-6
ISBN E-Book-Epub 978-3-86674-913-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Quote
Rasse
Rassismus
Verneinung
Schwarze Vernunft
Kapitalismus-Genese
Black lives matter
Antisemitismus
Xenophobie
Gender(n)
Sprachzerfall
Naturmetaphysik
Dank
Der Autor
Weitere Bücher von Christoph Türcke
Endnoten
Einleitung
»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«, sagt das deutsche Grundgesetz. Doch wer ist dieses »Volk«? Dass ihm Personen jeden Geschlechts, die in einem Land dauerhaft wohnen, ab einem Mindestalter zuzurechnen sind, leidet keinen Zweifel. Aber wann ist das Mindestalter erreicht, was heißt »dauerhaft wohnen« und ab wann trifft Letzteres auch auf Migranten, Flüchtlinge, Asylanten zu? Das ist nach wie vor strittig. Zwar gilt als unhintergehbarer demokratischer Standard, dass das Volk das Parlament wählt und dieses die Regierung, während ein oberstes Gericht darüber wacht, dass Parlament und Regierung verfassungsgemäß handeln. Aber wann hat das Parlament zu viel Befugnisse, so dass die Regierung handlungsunfähig wird, wann zu wenig, so dass sie selbstherrlich walten kann? Wann wacht das oberste Gericht lediglich über die Verfassung, wann beginnt es, sie als Hebel zu nutzen, um selbst politisch einzugreifen? Diese Fragen flammen in jedem Konfliktfall neu auf. Das rechte Maß demokratischer Kontrolle und Ausgewogenheit ist bis heute nicht erreicht.
»Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter?«, fragte Immanuel Kant 1783 und antwortete: »Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.«1 Entsprechend gilt heute: Wir leben nicht im Zeitalter der Demokratie; günstigstenfalls in einem der Demokratisierung. Die aber ist ständig von Rückschlägen bedroht. Längst wurde von »Postdemokratie«2 gesprochen: vornehmlich im Hinblick auf die globalen Finanzmärkte, bei denen sogar die vergleichsweise reichen und demokratieaffinen westlichen Staaten dermaßen verschuldet sind, dass ihre Regierungen und Parlamente immer mehr Entscheidungsspielraum verlieren. Durch »Schuldenbremsen« versuchen sie, gegenzusteuern – und sind nun durch die Coronapandemie zu horrenden Neuverschuldungen genötigt, deren Langzeitfolgen für die Finanzierbarkeit von Gesundheits- und Bildungssystem, von Sicherheitskräften und Verkehrsinfrastruktur noch ganz unabsehbar sind. Wenn die privaten Gläubiger dieser Billionensummen den Geldhahn zudrehen oder Börsenrallyes auf Staatsbankrotte anzetteln, dann können die parlamentarischen Entscheidungsprozesse noch so demokratisch angelegt sein; sie laufen leer. Gleichwohl lässt das Wort »Postdemokratie« einen irreführenden nostalgischen Ton mitschwingen, als ob es, ehe sich die Finanzmärkte in den 1970er Jahren auftaten, irgendwo auf dem Globus eine rundum intakte Demokratie gegeben hätte. Genau genommen sind auch die demokratieaffinsten Staaten nie mehr als »Prädemokratien« gewesen – nirgends weiter gekommen, als der kapitalistische Weltmarkt es zuließ.
Vom Weltmarkt ist allerdings fast nur noch in Nachrichten zum Stand der Börsen und der globalen Lieferketten die Rede, kaum mehr im Demokratiediskurs. Den fesseln heute entschieden kleinteiligere Formate, die erst das Internet mit sich gebracht hat. Ermöglicht es doch jedem, mit ein paar Klicks ganze Datensätze »ins Netz zu stellen« und sich direkt öffentlich zu artikulieren – vorbei an allen Volksvertretungen, Regierungen, Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehenanstalten; vorbei an allen Repräsentanten und Vormündern, die sich für entscheidungsbefugt darüber halten, ob das, was öffentlich artikuliert wird, auch öffentlichkeits-würdig ist. Seither gibt es neue Formen politischer Direktmanifestation. Gern nennt man sie basisdemokratisch; etwa wenn sich Menschen bemerkbar machen und Beachtung verlangen, die in Parteiprogrammen und öffentlichen Diskursen zuvor gar nicht vorkamen; Menschen, die anders sind als die Mehrheit: andere Hautfarben, andere sexuelle Orientierungen, andere Konfessionen, andere kulturelle Gepflogenheiten, andere Bedürfnisse aufgrund von Behinderungen haben. Noch nie konnten sie sich so nachdrücklich und vielfältig öffentlich artikulieren wie zu Internetkonditionen. Doch seit sie das können, gibt es auch einen Unmutsdiskurs darüber, wie wenig sie das können, wie sehr der neue Weg der Direktmanifestation, auf dem nun jeder so ziemlich alles Beliebige »ins Netz stellen« darf, ihre besonderen Belange untergehen lässt. Was nützen ihnen die technischen Mittel zur öffentlichen Direktartikulation, solange sie damit nicht durchdringen, solange ihr Anderssein nicht gebührend respektiert wird, solange Parteien und Parlamente es nicht durch rechtliche Gleichstellungsmaßnahmen schützen, die es »sichtbar« machen?
Wie Coca-Cola einen besonderen Durst nach Coca-Cola erzeugt, so das neue Gleichstellungsmedium einen besonderen Durst nach sichtbarer Gleichstellung. Internetgestützte Basisdemokratie läuft auf eine Politik der Gleichstellung der gesamten Minderheitenvielfalt hinaus. Sie geht mit einer neuen Utopie schwanger. In dem Maße, wie in Parlamente, Regierungen, Unternehmensleitungen, Gewerkschaften, Aufsichtsräte, Akademien, Polizeidirektionen, Offizierscorps und Börsen eine paritätische Geschlechts- und Minderheitendiversität einzieht, hören Benachteiligung und Ausgrenzung auf, schwindet die binäre patriarchale Weltordnung, wächst die Vielfalt, gleicht sich die Gesellschaft demokratisch aus, entstehen »diskriminierungsfreie Räume«. Was kümmert da noch der Weltmarkt oder der Klimawandel, den der Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum vorantreibt? Auch sie werden sich durch Paritätsverhältnisse moderieren lassen, in denen die Andersheit der anderen respektiert und niemand mehr »abgewertet« wird.
Eine geradezu biedermeierliche Utopie in digitalem Gewand, diese diskriminierungsfreie Paritätsdemokratie. Doch wie soll man in einer komplexen Gesellschaft Paritäten feststellen? Man wird leider nicht umhinkommen, sie auszurechnen – sie wohl oder übel gegeneinander aufzurechnen. Spätestens dabei wird es ungemütlich. Soll nur das Quantum der Betroffenen zählen oder auch die Schwere und die zeitliche Länge ihrer Benachteiligung? Jede Berechnung fußt auf Bewertungen, die man auch anders gewichten könnte. Jedes Verfahren der Paritätsermittlung beflügelt den Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, Einfluss und finanzielle Zuwendung. Unterm Strich stehen dann Prozentzahlen: Quoten. Bei ihnen setzt dieses Büchlein an. Angeblich schaffen sie mehr Gerechtigkeit und festigen das demokratische Fundament der Gesellschaft. Dabei tun sie eher das Gegenteil.
Quote
Gleichstellungsbeauftragte gibt es reichlich. Aber kommt die Gleichstellung der Geschlechter auch gut voran? Daran zweifelt neuerdings sogar eine starke Strömung in der CDU. Eine Bundeskanzlerin, mehrere Ministerinnen, eine Parteivorsitzende – das genügt ihr nicht mehr, zumal nicht gewiss ist, ob mit den ausschließlich männlichen Bewerbern um das Erbe von Angela Merkel das Rad nicht wieder zurückgedreht wird. Erst wenn bis hinunter auf die kommunale Ebene alle Parteifunktionen und -ämter zur Hälfte mit Frauen besetzt sind, könne von durchgesetzter Gleichstellung die Rede sein. Das sagen auch immer mehr einflussreiche Männer in der Partei. Sie freunden sich mit der Fünfzig-Prozent-Frauenquote an. Deren Einführung ist kaum mehr aufzuhalten.
Andere sind da längst weiter. Die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung hat ein Paritätsgesetz erlassen. Es besagt: Bei Landtagswahlen muss jede Partei auf ihren Kandidatenlisten immer abwechselnd einen Mann und eine Frau aufführen (»Reißverschlussprinzip«). Wenn sich nicht genügend Kandidatinnen finden, bleiben die entsprechenden Listenplätze leer. Nur so bekommen die Parteien den nötigen Druck, Frauen gleichzustellen. Prompt hat die AfD gegen dieses Gesetz geklagt. Ganz offen gibt sie zu, nicht genügend Kandidatinnen für die Wahllisten zu haben. Sie sieht sich dadurch benachteiligt und in ihrer Betätigungs- und Programmfreiheit als Partei eingeschränkt. Brisant: Eine männerdominierte Partei, die keinerlei ernsthafte Anstalten macht, ihren Frauenanteil zu erhöhen, reklamiert Chancengleichheit für sich. Und der Thüringer Verfassungsgerichtshof gibt ihr Recht! Parteien seien »frei, das Personal zu bestimmen, mit dem sie zu einer Wahl antreten wollen« – ohne Ansehen des Geschlechts. Auch das Recht, sich zur Wahl zu stellen, dulde keine Kontingentierung von Listenplätzen nach Geschlechterparität.
So urteilte im Juli 2020 ein Gericht aus sieben Männern und zwei Frauen. Die beiden Frauen und ein Mann gaben zwar ein Minderheitsvotum ab. Das Paritätsgesetz habe lediglich »die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik« »durch begünstigende Regelungen ausgeglichen«, indem es »die Chancengleichheit von Männern und Frauen fördere, aber nicht ein paritätisch besetztes Parlament garantiere«.3 So habe es nach wie vor die Verteilung der Direktmandate nach Wählerstimmen vorgesehen, nicht nach Paritätsgesichtspunkten. Doch die Mehrheit von sechs Männern teilte die Sicht der AfD. Deren Thüringer Landesvorsitzender Björn Höcke, der Exponent jenes Partei-»Flügels«, der wegen vielfach aktenkundiger rechtsextremer Programmatik unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, durfte die Entkräftung eines Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung genüsslich als Sieg der Demokratie verbuchen. Wenige Monate später, im Oktober, gab auch in Brandenburg das Landesverfassungsgericht dem Einspruch von NPD und AfD gegen das ›Reißverschluss‹-Paritätsgesetz statt, das die rot-rot-grüne Mehrheit im Potsdamer Landtag durchgesetzt hatte – mit den gleichen Argumenten. Schließlich wies im Februar 2021 das Bundesverfassungsgericht die Klage einer Gruppe von Frauen ab, die die Gültigkeit der Bundestagswahl 2017 wegen fehlender Paritätsregeln bestritt. In all diesen Gerichten sind Frauen in der Minderheit. Könnte das parteiübergreifende Komplott weißer Männer offensichtlicher sein?
Nicht aus der Perspektive derjenigen, die in flächendeckender paritätischer Besetzung von Funktionen und Posten die Vollendung der Gleichstellung sehen – und das grundsätzliche Dilemma ignorieren, in dem der Begriff der Gleichheit steckt. Dass alle Menschen gleich seien, widerspricht jeglichem Augenschein. Jeder ist anders als die anderen und nur deshalb ein Individuum. Gleichheit gibt es immer nur in bestimmter Hinsicht: etwa des Alters, des Geschlechts, der Sprache, Ethnie, Hautfarbe, Nation, Religion, sozialen Klasse etc. Gleichheit als Menschenrecht ist zwar eine große, nicht wieder preiszugebende Errungenschaft, aber auch bloß eine Hinsicht. Sie besagt: Die Menschen eines Gemeinwesens mögen noch so verschieden sein, was Körperbeschaffenheit, Tätigkeit, Bildung, Einkünfte oder Lebensqualität betrifft. Als seine Bürger »sind sie vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.«
Wer hätte gedacht, dass es um diese schlichten Worte aus Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes (GG) einmal große Auslegungsdebatten geben würde? Heißt Gleichheit nicht eindeutig gleicher Zugang zu allem, was allen rechtlich zusteht: zu Bildung, Pflege, medizinischer Behandlung, öffentlichen Transport- und Kommunikationsmitteln, zu allen Konsumgütern, Wohnungen, Reisezielen, die man erschwingen kann, zu allen Berufen, für die man geeignet ist, zu allen Parteien, Vereinen, Glaubensgemeinschaften, die verfassungsgemäß sind? Diese kleine Aufzählung zeigt schon, wo der Haken ist. Nicht alle Weltanschauungen sind verfassungsgemäß; nicht alle Menschen sind für alle Tätigkeiten geeignet; nicht alle können alles erschwingen. Der Tochter der alleinerziehenden Verkäuferin und dem Sohn des Rechtsanwaltsehepaars stehen zwar das gleiche Schulsystem und die gleiche Berufswelt offen. Doch nur in den seltensten Fällen werden sie in der Lage sein, ihre rechtlich gleichen Chancen in gleicher Weise zu nutzen. Gleichberechtigung ist nicht schon Gleichstellung. Deswegen sind Gleichstellungsbeauftragte so wichtig, die darüber wachen, dass im Berufsalltag Frauen tatsächlich nicht benachteiligt oder belästigt werden und niemand unter seiner sexuellen Orientierung zu leiden hat. Auch in den Schulen gibt es so etwas wie Gleichstellungsbeauftragte: Förderlehrer, die sich lernschwachen Kindern aus prekären Verhältnissen widmen und deren soziale Benachteiligung so gut wie möglich auszugleichen versuchen.
Doch beim Übergang von der Gleichberechtigung zur Gleichstellung bleibt immer eine Lücke. Nur zum Teil kann sie rechtlich gefüllt werden: etwa durch Gesetze, die Gewalt in Ehe und Partnerschaft, Mobbing in Betrieben und Einrichtungen ahnden oder durch Bestimmungen, die bei Bewerbungen für einen Job im Falle gleicher Qualifikation die Bewerberin dem Bewerber vorziehen. Letzteres ist bereits grenzwertig. Bezieht sich Artikel 3 GG doch auf Individuen, nicht auf Gruppen. Dass, nachdem Frauen jahrhundertelang benachteiligt waren, nun auch mal einige von ihnen bevorzugt werden sollen, ist zwar ein verständlicher Wunsch. Doch ausgleichende Gerechtigkeit kann nicht in alternativer Rechtsbeugung bestehen. Der Mann, der leer ausgeht, obwohl er nicht minder qualifiziert war als seine Mitbewerberin, hat Anlass, sich wegen seines Geschlechts benachteiligt zu fühlen. Geschickte Auswahlbeauftragte regeln das Problem so, dass sie die ausgewählte Person für die geeignetste erklären. Qualifikation ist ein dehnbarer Begriff.
Es tut sich hier eine Grauzone auf, in der rechtliche Maßnahmen wenig ausrichten. Gleichstellungsbeauftragte können oft Ungleichbehandlung vermindern, selten ganz verhindern und schon gar nicht völlige Gleichstellung durchsetzen. In einem Betriebsklima anzüglicher Redeweisen und scherzenden Augenzwinkerns bekommen sie manche Formen von Mobbing und Ungleichbehandlung gar nicht in einklagbarer Weise zu fassen. Andrerseits tun sie sich und dem Betriebsklima keinen Gefallen, wenn sie jeden Scherz sogleich unter Mobbing-und jedes Kompliment unter Belästigungsverdacht stellen. Gleichstellung zu überwachen hat immer etwas von informellem Balancieren. Und in der Privatsphäre gibt es gar keine Gleichstellungsbeauftragten. Wie soll dort die Doppel- oder Dreifachbelastung von Frauen aufhören, die sich neben ihrem Beruf auch noch um Haushalt und Kinder kümmern müssen, weil ihre Männer dazu nicht bereit sind? Wie soll die Gleichstellung von Frauen gelingen, die vor ihren gewalttätigen Männern in Frauenhäuser fliehen, aber dann doch wieder zu ihnen zurückkehren? Da helfen weder Ordnungsämter noch Gerichtsvollzieher, sondern allenfalls Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Seelsorger oder Therapeuten – flankiert von einer gründlichen Erziehung zu Umgangsformen, die patriarchale Männlichkeit deheroisieren und als asozial brandmarken. Aber die fällige Emanzipation davon müssen die Betroffenen in ihrem Alltagsverhalten selbst vollziehen. Kein Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nimmt ihnen diese langwierige Arbeit ab.
Zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung liegt unumgehbar ein zivilgesellschaftlicher Prozess. Der kommt umso besser voran, je beherzter die Deheroisierung falscher Männlichkeit betrieben wird. Aber er braucht Beharrlichkeit und Geduld – zwei Eigenschaften, die in einer auf Digitalisierung und Beschleunigung fixierten Umgebung ganz uncool sind. Wo sie schwinden, wächst die Neigung, sie durch rechtliche Regelungen zu ersetzen. Ohne verbindliche Frauenquoten wird es nie etwas mit der Gleichstellung, ist dann die Devise. Sie gibt offen zu, dass sie dem zivilgesellschaftlichen Vorankommen an der Basis misstraut. Deshalb setzt sie von vornherein eine Etage höher an: auf der Vorgesetztenebene, bei den Funktions- und Amtsträgern. Deren Zahl soll gleichmäßig zwischen den Geschlechtern verteilt werden. Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen wird dabei gar nicht thematisiert, stattdessen einem Glauben gehuldigt, der in der Wirtschaftstheorie Trickle down heißt und besagt: Wo die großen Wirtschaftsunternehmen boomen, da gehe es über kurz oder lang auch ihren Mitarbeitern, ja der ganzen Bevölkerung besser. Der Reichtum »sickere« nach unten »durch«.4 Das ist neoliberale Augenwischerei. Der Abstand zwischen Ärmsten und Reichsten wächst drastisch.5 Doch die Geschlechterparität soll nach Trickle-down-Logik funktionieren. Wenn alle Posten in Parteien, Behörden und Aufsichtsräten, im Management und beim Militär gleichmäßig mit Frauen und Männern besetzt werden, werde die Welt zunächst auf Postenebene ausgeglichener. Das »Durchsickern« dieser Gleichstellung zur Basis sei dann nur noch eine Frage der Zeit.
Von ihrer Nähe zur neoliberalen Wirtschaftsdoktrin nimmt die Paritätskampagne, die sich als »linkes« Projekt versteht, keine Notiz. Umso mehr arbeitet sie an der Formalisierung und Verrechtlichung jener zivilgesellschaftlichen Sphäre, deren Stärkung sie propagiert, deren Lebenselixier jedoch gerade das Informelle ist. Diese Sphäre braucht einen Rechtsrahmen, aber einen, der sich dabei bescheidet, ihr den informellen Freiraum zu erhalten. Emanzipation ist ein Reif- und Selbständigwerden, das nur in solchem Freiraum gedeihen kann. Es lässt sich ebenso wenig wie moralisches Handeln gesetzlich verordnen. Wo das dennoch versucht wird, lebt das Recht über seine Verhältnisse. Nicht ausgeschlossen, dass es damit erst einmal Erfolg hat. Die Landesregierungen in Thüringen und Brandenburg planen schon eine neue Version des Paritätsgesetzes. Vielleicht haben sie im zweiten Anlauf mehr Glück. Vielleicht folgt ganz Deutschland bald Frankreich, das bereits 1999 den Artikel 1 seiner Verfassung um »den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu den Wahlmandaten und auf Wahl beruhenden Ämtern sowie zu den Führungspositionen im beruflichen und sozialen Bereich«6 ergänzte und so die Benachteiligung der Frauen auf Funktions- und Amtsebene beseitigte, sich aber um all die Benachteiligungen, die untergebenen Frauen und Männern durch den Machtumfang von Führungspositionen entstehen, nicht scherte.
Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass sich das rächen wird. Es gibt Personen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen und dennoch Geschlechtswesen sind. Bei ihnen im Personenstandsregister unter »Geschlecht« lediglich »keine Angabe« einzutragen, erachtete das Bundesverfassungsgericht als verunglimpfend. Es befand, dass ihnen nach Artikel 3 GG ein eigener Geschlechtsstatus zustehe, und nannte ihn »divers«. Die üblichen öffentlichen Stellenausschreibungen müssen seither ausdrücklich kenntlich machen, dass sie für alle drei Geschlechter gelten: »m/w/d«. Noch ist der Prozentsatz der Diversen verschwindend gering, aber die Zahl derer, die sich geschlechtlich anders fühlen, als sie anatomisch sind, wächst exponentiell. Und welches verfassungskonforme Argument könnte Menschen, die sich für divers erklären, von der geschlechtergerechten Posten-und Ämterverteilung ausschließen? Sobald sie eine Beteiligung daran verlangen, ist die Fünfzig-Prozent-Quote dahin. Vielleicht haben sie zunächst noch weit weniger Personal zur Postenbesetzung, als die AfD derzeit über wählbare Frauen verfügt. Dann könnten sie die von ihnen unbesetzten Posten von Personen ihrer Wahl vertreten lassen. Aber ein prozentualer Anteil steht ihnen zu. Um ihn bei sich ständig verändernder Zahl der Diversen gerecht zu berechnen, werden Zahlenspiele unausbleiblich sein. Und da »divers« als Sammelbegriff für einen unbestimmten Plural von Sexualitäten und sexuellen Orientierungen steht (LGBTTI), müssen die darunter Befassten sich ihrerseits auf Anteile einigen, die ihnen davon zustehen.
Die Einbeziehung der Diversen in die Gleichstellungsparität setzt keinen Schlusspunkt. Sie eröffnet vielmehr einen schwer aufhaltbaren Reigen der Diversifizierung. Warum soll nur wegen seines Geschlechtes niemand benachteiligt oder bevorzugt werden? Artikel 3 nennt noch einiges andere: zum Beispiel Abstammung, Herkunft, religiöse und politische Anschauungen. »Der Islam gehört zu Deutschland«, sagte Bundespräsident Wulf und machte damit auf den hohen Anteil muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbürger aufmerksam. Der bildet sich in der Zusammensetzung des Parlaments nicht ab. Wie sollen die Belange dieser Bevölkerungsgruppe angemessen berücksichtigt werden, solange ihr nicht eine bestimmte Zahl von Abgeordneten zusteht? Die Abtragung der Schuld, die seit der Shoah auf Deutschland lastet, ist ein offiziell erklärtes Grundanliegen deutscher Politik. Wie ernst ist es ihr, solange sie den Juden in Deutschland nicht eine ihrem Bevölkerungsanteil entsprechende Abgeordnetenzahl vorbehält? Viele benachteiligte Gruppen sind damit noch gar nicht genannt: etwa die Personen dunkler Hautfarbe, die bei der Stellen- und Wohnungssuche meistens hintanstehen, umso häufiger aber Objekte anlassloser Polizeikontrollen sind; die vielen Menschen mit Behinderungen, deren Bewegungsfreiheit samt Bildungs-, Bewerbungs- und Beziehungschancen eingeschränkt ist; die vielen Alten, die zur Wahrnehmung ihrer Rechte kaum mehr in der Lage sind. Wie soll ihre strukturelle Benachteiligung enden, solange ihnen keine authentische parlamentarische Stimme, also keine paritätische Volksvertretung durch Betroffene eingeräumt wird?
Es gibt kaum mehr ein Halten, wenn die Pandorabüchse der Gleichstellung durch Paritäten einmal geöffnet ist. Artikel 3 GG wird dann zu etwas, was seinen Urhebern völlig fern lag: ein Brutkasten für Quoten. Mit erheblichen Folgen für die Rolle der Abgeordneten. Diese sind laut Artikel 38 GG »Vertreter des ganzen Volkes«, aber »an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen«. Ist das ein Freibrief für sie, eigene Interessen über den Wählerwillen zu stellen? So war es natürlich nicht gemeint. Aber den Freiraum, das zu tun, eröffnet ihnen Artikel 38 durchaus. In ihr Gewissen kann ja niemand hineinschauen. Doch was wären sie ohne diesen Freiraum? Könnte man sie etwa auf einen lückenlos definierten Wählerwillen vereidigen? Vergebliche Mühe.
Der Wählerwille hört nie auf, ein interpretationsbedürftiges Kräfteparallelogramm von Einzelvoten zu sein. Ohne über einen Gewissensfreiraum zu verfügen, der nie ganz immun gegen Missbrauch ist, können Abgeordnete nicht verantwortlich handeln, sind sie doch nicht nur den Interessen einer bestimmten Wählerklientel verantwortlich, sondern dem Gemeinwesen als Ganzem, das ständig die Abwägung zwischen höheren und niederen, dringlicheren und weniger dringlichen Motiven und Interessen verlangt. Jemanden wählen heißt, ihm dafür Spielraum zu geben – einen Vertrauensvorschuss für ein schwer vorhersehbares Balancieren. Wer diesen Vorschuss nicht geben mag, weil Wahlversprechen fast nie voll erfüllt werden, muss sein Wahlrecht ruhen lassen.
Paritätisch gewählte Abgeordnete sind hingegen in erster Linie Gleichstellungsbeauftragte einer Gruppe. Strukturell ähneln sie Lobbyisten. Das sind Leute, die bei Politikern vorsprechen, um sie für die Belange bestimmter Einrichtungen empfänglich zu machen: meistens für die Geschäftsinteressen von Firmen, gelegentlich auch für die Anliegen von Sozialverbänden, Religionsgemeinschaften etc. Lobbyisten werden dafür bezahlt, dass sie bestimmten Gruppeninteressen in Parlament und Regierung Gehör verschaffen. Paritätsabgeordnete werden dafür gewählt, dass sie bestimmte Gruppeninteressen im Parlament durchsetzen. Der Lobbyismus ist eine informelle Grauzone – gelegentlich eine dunkelgraue Schmuddelecke der Zivilgesellschaft (die ja keineswegs bloß aus emanzipatorischen Bürgerinitiativen besteht). Die Bestellung von Paritätsabgeordneten erfolgt hingegen nach Paragraphen und transparenter Proporzberechnung. Sie läutert den Lobbyismus zum legalen politischen Hauptgeschäft.
»Lobby« ist bekanntlich der Name für den Vorraum zum Parlament. Mit dem Paritätsproporz verschiebt sich die Lobby gewissermaßen in den Parlamentssaal selbst. Mögen Paritätsabgeordnete auch weiterhin »nur ihrem Gewissen unterworfen« sein, so ist doch ihr Gewissen nun seinerseits bestimmten Gruppenbelangen unterworfen. Der Grad ihres Engagements für die jeweilige Gruppe muss sich dadurch nicht erkennbar ändern. Er zeigt ohnehin nie zuverlässig an, ob ihr Gewissen den Angelpunkt ihrer Eigenverantwortung ausmacht oder nur als das gewissenhafte Ausführungsorgan eines Gruppenauftrags zum Zuge kommt. Dennoch hängt von diesem Unterschied das Gesamtverständnis von Volksvertretung ab. Es ist etwas grundlegend anderes, ob das Gewissen als Ich oder als Über-Ich fungiert. Im zweiten Fall nähern sich die Gruppenbelange, für die jemand gewählt wurde, einem imperativen Mandat an. Sie gewinnen selber den Rang einer Gewissensinstanz, die zwar rechtlich nicht einklagbar ist, jedoch als konstantes moralisches Druckmittel wirkt.
Wir bekommen die Gleichstellung nicht hin, wenn wir sie nicht durch ein rechtlich verbrieftes Quantum von Posten regeln: Das ist das kaum verhohlene Geständnis hinter der Frauenquote – und das Muster aller weiterer Gleichstellungsinitiativen: für People of Color, Menschen mit Behinderungen, Muslime oder Juden. Unterstellt wird dabei stets, dass Gleichstellung nur dann funktioniert, wenn direkt Betroffene diese Posten bekleiden, weil nur sie wissen, was es heißt, unter der jeweiligen Benachteiligung zu leiden. Fürsprache ist nur dort authentisch, wo man für seinesgleichen spricht, für eine homogene Gruppe, mit der man Betroffenheit, Erfahrungen und Einstellungen teilt: Das ist der gemeinsame Grundsatz aller Bestrebungen, die heute unter »Identitätspolitik« firmieren. Müssten dann nicht auch Kinder und Gefängnisinsassen in die Gremien, wenn deren Belange authentisch vertreten werden sollen? Fragen dieser Art werden gern ausgeblendet. Sie stören die identitätspolitische Gleichsetzung von Betroffenheit und Kompetenz. Wer nicht zu den Betroffenen gehört, ist nicht legitimiert, sie zu vertreten. Er ist mit ihren Belangen nicht wirklich vertraut, kann sie nur verwalten, nicht teilen, ihnen nur eine Stimme leihen, die nicht ihre ist. Er entwendet ihnen »ihr Ding«.
Hütet euch vor Fremden in der eigenen Gruppe, ist die identitätspolitische Elementarbotschaft – eine xenophobe Engführung des Repräsentationsgedankens.7 Repräsentation hat stets zwei gegenläufige Tendenzen: das Sprechen anstelle von anderen, das sie bevormundet; und das Sprechen für andere, das den Belangen derer Nachdruck verleiht, die sich aufgrund ihres Alters, ihrer Konstitution oder sozialen Lage nicht selbst Gehör verschaffen können. Oft verschwimmen diese beiden Tendenzen ineinander. Jedenfalls sind sie nicht keimfrei voneinander trennbar. Auch wer nur für seinesgleichen spricht, spricht dabei immer auch für Individuen, die anders sind als er selbst. Dass etwa die mittelständische Abgeordnete auch für Migrantinnen spricht, nicht nur für mittelständische Frauen, oder ihr körperlich behinderter Kollege nicht nur für körperlich, sondern auch für geistig Behinderte – das wird identitätspolitisch gewöhnlich zwar nicht beanstandet, gelegentlich sogar begrüßt. Aber dass Repräsentation ohne eine Prise Empathie für andere gar nicht möglich ist; dass die Fähigkeit, die Belange anderer empathisch zu den eigenen zu machen, die Signatur von Solidarität ist – das hat in diesem Denkmuster keinen Ort. Empathie ist ihm vornehmlich eine Chiffre für Übergriffigkeit. Deshalb die Gleichsetzung von Betroffenheit und Kompetenz. Jede benachteiligte Gruppe soll ihre Sprecherquote möglichst ganz aus sich selbst rekrutieren. Eine bevormundungsfreie Sprechervielfalt, eine unbegrenzte Diversifizierung der Gleichstellung wird proklamiert, aber durch xenophobe Mentalität, nach der Devise: Vertrauen können wir nur Leuten aus unserm Stall.
Eine neue Form von Clandenken zieht damit ins Parlament ein – auf dem Niveau internetgestützter, hoch mobiler Gruppenbildungsprozesse. Zur Erinnerung: Die historische Vorform des demokratischen Parlaments war die Ständeversammlung aus Klerus, Adel und, mehr geduldet als respektiert, dem dritten Stand der Bürger. Mit der französischen Revolution schwang sich der dritte Stand zum allgemeinen Bürgerstand auf. Klerus und Adel verloren ihren Ständestatus. Sie wurden sozusagen in die Lobby gedrängt. Dort haben sie nicht aufgehört, zugunsten ihrer Interessen auf Abgeordnete einzuwirken – im Verbund mit der neuen bürgerlichen Wirtschaftsmacht, die nicht bloß ein Stand ist, sondern sich als Geschäftsgrundlage des gesellschaftlichen Ganzen etabliert hat. Der moderne Parlamentarismus arbeitet auf dieser Grundlage. Er bekommt ihre Dornen nicht weg: den Dauerzwang zu wirtschaftlichem Wachstum, zur Einsparung von Lohnkosten, zur Massenentlassung von Arbeitskräften, zu untilgbarer Staatsverschuldung. Er bekommt auch die lobbyistische Grauzone an seinen eigenen Rändern nicht weg. Deren Paradigma aber ist die Wirtschaftslobby. Von ihr haben alle weiteren Lobbys gelernt, wie man Druck auf Parlament und Regierung ausübt. Immerhin ist dieser Druck nicht rechtsverbindlich. Die Volksvertreter sind ihm, solange sie »nur ihrem Gewissen unterworfen« sind, nicht ausgeliefert. Sie können ihn zurückweisen, abfedern, für eigene parteipolitische Vorhaben nutzen. Dieser Freiraum schrumpft, wenn sie als Gleichstellungsbeauftragte einer bestimmten Gruppe im Parlament sitzen und damit selbst zu Lobbyisten tendieren.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.