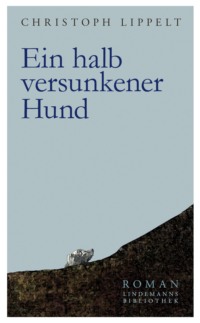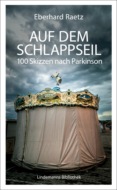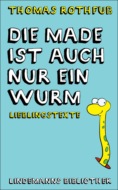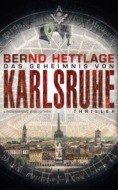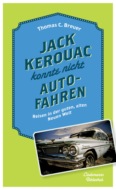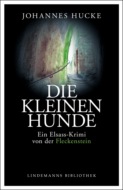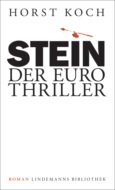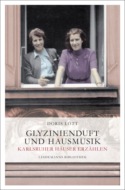Buch lesen: "Ein halb versunkener Hund"

Christoph Lippelt
Ein halb versunkener Hund
Roman

Das Vergangene ist nie tot –
es ist nicht einmal vergangen.
William Faulkner
Die Menschen und die Landschaften
in diesem Roman sind Erfindungen.
Die geschilderten Schicksale
gibt es so in der Wirklichkeit nicht,
obgleich sie in der unergründlichen Tiefe
der Zeit vorstellbar wären.
1
Über Ludger Hyazinth von Freyenfeld, der sich Lude Frey nennt, und die Personen, mit denen er auf Schloss Fürstenau Umgang hat.
Sie waren zu viert. Zwei Frauen und zwei Männer. Sie hatten sich in den vergangenen Monaten schon oft vor dieser Tür getroffen. Vor dem Rumor hinter dieser Tür. Sie waren die Verantwortlichen. Die Hausmutter, die Flurmutter, der Schlossvater, der Vogt. Anastasia Kolumzik, Erika Hattenkerl, Hans Ströhle und Wilhelm Wirth.
Man nannte sie: „’s Gretle“, die „Kerl“, „Adolf“ und der „Hammer“.
Die Kolumzik mag sein wegen ihres langen blonden Zopfes, den sie zum Kranz um ihren Kopf geschlungen trug. Die Hattenkerl wegen ihres Namens und ihrer stattlichen, säulenartigen Figur. Ströhle vielleicht, weil er in diesem anrüchigen Nazi-Schloss der Chef war, dunkles, straff gegeltes Haar mit Seitenscheitel und immer graue Anzüge mit Krawatte trug. Damit ähnelte er, auch ohne Oberlippenbärtchen, jenem anderen Adolf durchaus ein wenig. Und Wirth wohl wegen seiner Werkzeuge und seiner unglaublichen Kraft.
Spitznamen, die sich so herausgebildet hatten, an Neuankömmlinge weitergegeben wurden und die auch der Verwirrteste und Behindertste, selbst wenn er sie nicht aussprechen, ja womöglich gar nicht hören konnte, schnell kapierte.
Offiziell waren die Pfleglinge gehalten, die Hüterinnen mit „Mutter“, den Leiter mit „Vater“ und den Hausmeister, der hier Vogt hieß, mit „Herr Vogt“ anzureden. Auch das taten sie, wenn sie es konnten und verstanden, gerne und oft. So brabbelten, riefen, jauchzten sie vielmal hintereinander „Mutter-Mutter-Mutter“, „Vater-Vater-Vater“, sinnlos scheinbar, aber vielleicht erinnerten sie diese Worte doch an ihr verlorenes Zuhause. Manchmal schimpften sie auch mit ihnen. Verzerrten, verstöhnten, verknirschten sie, konnten mit ihnen schluchzen. Die Spitznamen jedenfalls waren einfacher als die bürgerlichen, sie machten Spaß, und die Pfleglinge hatten sozusagen etwas Eigenes.
Die Hüterinnen waren keine Unmenschen. Sie waren durchweg zwischen vierzig und fünfzig, ledig, sehr stabil gewachsen und hatten alle einen Kurs in Selbstverteidigung hinter sich, der regelmäßig wiederholt wurde. So konnten sie bei Widerstrebenden kräftig zupacken und bei aufflammender Aggression blitzschnell reagieren. Aber das geschah äußerst selten, denn eine Grundmedikation sänftigte die Pfleglinge durch die Bank.
Bis auf einen, der versuchsweise gar nichts bekam.
So waren diese leicht bedrohlich aussehenden Mütter alles andere als eine Bedrohung. Im Gegenteil. Sie walzten mit ihren umfänglichen Leibern, die in hochgeschlossene, hellgraue Kleider mit dunkleren Umschlägen gehüllt waren, mit einer Ruhe, die jeden Widerspruch im Keim erstickte, durch die Flure. Die Füße leicht auswärts gestellt in schwarzen, halbhohen Schuhen, die beim Gehen hackende Geräusche erzeugten. Sie trugen keine Hauben, bis aufs Gretle, einheitlich kurz geschnittenes Haar, keinerlei Schmuck und knapp unter der Gurgel ein dreikommafünf Zentimeter großes, rundes Abzeichen mit zwei roten, stilisierten Händen, die ein rotes Gesicht umfassten, auf weißem Grund.
Das waren die Vorschriften.
Sie gehörten dem evangelischen „Bund der Barmherzigen“ an und konnten es sich leisten, freundlich und zugewandt zu sein, zuhörend und tröstend.
Und wenn alle Stricke rissen und tatsächlich einmal ein Pflegling, etwa eine irritierte Neuaufnahme, ausflippte, war da immer noch Wilhelm Wirth, der Vogt.
Ein merkwürdiges Männlein.
Spindeldürr mit graugelblicher Haut, wenigen Kringelhaaren auf dem nackten Schädel und immer ein bisschen gekrümmt. Er hatte eine mächtige Nase und ein ebensolches Kinn, hinter denen sich sein übriges Gesicht sozusagen verlor, obgleich da noch eine dickglasige Brille vor zusammengekniffenen Augen zu finden war und vorstehende Zähne, die unter seiner Oberlippe hervorsahen.
Bemerkenswerter jedoch waren seine riesigen Hände und Füße. Und diese Hände ersetzten glattweg einen Schraubstock. Doch ungeachtet seiner körperlichen Kräfte war Wilhelm Wirth ein ungemein ängstlicher Mensch. Wenn man ihn nur ansprach, zuckte er schon zusammen und schien sich fort zu ducken. Und wenn er selbst einmal etwas sagte, fuchtelte er dabei so mit den Armen in der Luft herum, als wollte er etwas von sich wegscheuchen. Als man in seiner Jugend versucht hatte, ihm die Zähne zu regulieren, war er vor Schreck in solch wilde Krampfzustände gefallen, dass man sehr schnell die Finger von ihm gelassen hatte.
Unsichtbar unter seinem blauen Anton trug er stets eine zusammenschiebbare Stahlrute und ein flaches Elektroschockgerät mit sich herum. Nur so fühlte er sich einigermaßen sicher. Er hatte diese Dinge noch kein einziges Mal benutzt und war auch im Übrigen friedfertig und zuverlässig. Man nannte ihn den „Hammer“, weil er eigentlich immer irgendein Werkzeug in seinen gewaltigen Händen hielt. Dass allerdings sein Zeugungswerkzeug ebenfalls ein wahrer Hammer sein sollte, war eher ein Gerücht.
Ströhle war etwas undurchsichtig, von korrekter, leicht steifhüftiger Freundlichkeit und immer wie aus dem Ei gepellt. Als Chef des Ganzen hielt er deutlich Abstand zu den anderen, hatte eine leise Stimme und setzte durch, was er durchsetzen wollte.
Es hieß, er komme aus kleinen Verhältnissen, habe sich bei der Kirche hochgearbeitet, sei geschieden und mit Anastasia Kolumzik näher bekannt. Genaueres wusste man nicht.
Aber es war da etwas mit seinen Augen.
Ganz selten veränderte sich plötzlich ihr Ausdruck hinter der randlosen Brille. Man glaubte dann in schwarze ausgestanzte Löcher zu sehen, aus denen ein so eiskalter Hauch zu wehen schien, dass man eine Gänsehaut bekam. Ströhle hatte auch das Experiment mit Lude Frey, oder wie man den Umgang mit diesem Pflegling nennen sollte, erdacht und begonnen.
Nicht recht klar war auch, warum er den Spitznamen „Adolf“ bekommen und wer ihn zuerst so genannt hatte.
Überhaupt diese Gerüchte, Ahnungen, halben Kenntnisse über Schloss Fürstenau.
Die Gebäude waren alle renoviert, hell, freundlich, modernisiert, es herrschte ein milder Ton und die Pfleglinge schienen sich wohlzufühlen. Alle Angestellten gehörten eben diesem „Bund der Barmherzigen“ an und waren lange nach dem Krieg geboren. Keine einzige Familiengeschichte wies Bezüge zu den schrecklichen Geschehnissen von Fürstenau auf.
Und doch war es, als seien die Mauern, Decken, Böden, Türen, die ganze Gegend ringsum für immer getränkt von Entsetzen, Qual, Niedertracht und Mord. Als würden das Grauen und die Vernichtung untilgbar aus Häusern, Wiesen und Waldstücken steigen und in die Lebenden eindringen.
Alle Angestellten ahnten das mehr oder weniger, fragten sich wohl auch manchmal, warum man ausgerechnet dort wieder eine Anstalt für Behinderte und psychisch Kranke eingerichtet hatte. Aber dabei blieb es.
Vielleicht litt Ströhle am meisten, weil er sich manchmal durchaus vorstellen konnte, dass er auch damals Direktor hätte sein können und das systematische Morden geleitet hätte. Das erschreckte ihn immer wieder. Sein Verhältnis zu den Pfleglingen war geprägt von Ekel und eisern durchgehaltenem Mitleid. Von dem Unverständnis über die Irr und Wirrwege der Natur und dem unbedingten Wunsch, der Entartung so etwas wie eine erzwungene Normalität entgegenzusetzen.
In dieser Zerrissenheit war ihm Ludger von Freyenfeld, der sich seit kurzem Lude Frey nannte, wie ein Geschenk des Himmels erschienen. An diesem Prachtkerl und sanften Berserker wollte er ein Exempel statuieren. Obgleich Freyenfeld schizophren war, setzte Ströhle doch bei den Begriffen „Genie und Irrsinn“ ganz auf „Genie“ und wollte beweisen, dass, wenn man das Genie nur ganz und gar behütete – auch vor dem eigenen Irrsinn behütete –, sich dieses zur Freude aller entwickeln würde.
Der visitierende Psychiater allerdings war skeptisch.
Wenn man die Medikamente absetzte, könnten das Bilderstürmen und die Stimmenwirbel den Ludger durchaus in den Suizid treiben, zumindest seine Genialität lähmen und verschütten, statt sie zu fördern, gab er zu bedenken. Doch er wusste das auch nicht so genau.
Der Pflegling Freyenfeld hatte sich jeglicher Gesprächstherapie verweigert und was Doktor Liebrecht von dessen Zuständen wusste, hatte er als einer der Lauscher an der Tür mitbekommen, hinter der sein sonst stiller und in sich gekehrter Patient manchmal gegen seine optischen und akustischen Halluzinationen antobte und -brüllte. Und das in so wilder Intensität und wirrem Durcheinander, dass er sich vorgenommen hatte, das Geschrei zum besseren Verständnis, vielleicht auch um daraus einen Therapieansatz abzuleiten, aufzuzeichnen und zu analysieren.
Zu diesem Zweck hatte man dem Ludger nicht etwa ein Aufnahmekästchen, ähnlich wie bei einem Vierundzwanzigstunden-Elektrokardiogramm, auf die Brust geschnallt. Das hätte dieser nie geduldet. Man klebte ihm ein solches unter den Schrank in seinem Zimmer und verlängerte die Laufzeit auf mehrere Tage. So kam Doktor Liebrecht zu detaillierten Bildbeschreibungen von wüsten Gelagen, Verfolgungen, Blitzgewittern und Mordtaten und verstand immer besser die schreienden Dialoge zwischen seinem Patienten und irgendwelchen Dämonen und Gespenstern. Das war ein besonders höllisches Tohuwabohu, weil Ludger neben seinen Antworten auch die inneren Einreden mit herausbrüllte und zusätzlich gehörte Töne und Geräusche auszudrücken versuchte. Viel war von Füchsen, Schwänen und Genitalien die Rede. Bei der Bearbeitung der Aufnahmen registrierte der Psychiater bei sich selbst eine gewisse kurzatmige Neugier und leise Geilheit, was er auf seine berufsbedingte Sensibilität zurückführte.
Des Weiteren gab er zu bedenken, dass der solcherart gequälte Pflegling ohne seine dämpfenden Medikamente wieder so schrecklich zu trinken anfangen könnte, was ihn vollends ruinieren würde. Das Trinken als Eigentherapie gegen das innerliche Rasen habe ja schon einmal funktioniert, bis allerdings der Patient zusammengebrochen und in die Psychose gefallen sei.
Dabei wusste der gute Mann nicht, dass Lude Frey das schon selbst ausprobiert hatte.
Fürstenau lag in der Einsamkeit. Hier gab es nichts zu kaufen. Aber sein Vater, der ihn manchmal besuchte, hatte ihm etwas „für den Notfall“ mitgebracht und auch eine Küchenhilfe, der er schöntat, hatte ihm eine Flasche besorgt. Da aber seine Leberzellen kaum noch funktionierten und die größten Teile des Organs nur noch aus Fett und Bindegewebe bestanden, die nichts Zusätzliches entgiften konnten, wurde ihm jedes Mal nach wenigen Schlucken so spei und todeselend, dass seine Qualen nur zunahmen und er den Versuch von selbst aufgegeben hatte. Von dort also bestand keine Gefahr mehr.
Doch Ströhle ließ nicht locker.
Er hatte ein gutes Gespür für Menschen und ahnte, dass er mit Lude Frey etwas ganz Besonderes in seinem Machtbereich hatte. Etwas von dem Glanz auf seine Einrichtung und auf ihn selbst fallen könnte. Und als Doktor Liebrecht ihm von der Auswertung der Aufzeichnungen aus Ludes Zimmer berichtete, stellte er mit einigem Schauder fest, dass dessen Visionen gar nicht so weit entfernt waren von seinen eigenen Albträumen. Direktor Ströhle schloss daraus, dass die Grenze zwischen normal und nicht normal vielleicht doch sehr unscharf sein könnte, und befahl, sämtliche Medikamente bei dem Pflegling Ludger Hyazinth von Freyenfeld abzusetzen, neben dessen Zimmer einen weiteren Raum für ihn als Atelier freizuräumen und den ständig vor sich hinkritzelnden und klecksenden Mann mit ausreichendem Malmaterial zu versorgen.
Als von Freyenfeld – ein knapp vierzigjähriger, großer, schwerer, fast kahlköpfiger Mensch mit starren dunkelbraunen, eng stehenden Augen und einem kleinen hellroten, dicklippigen Kussmund – vor Monaten in das Pflegeheim Schloss Fürstenau des „Bundes der Barmherzigen“ aufgenommen wurde, begleitete ihn eine voluminöse Akte, in der alle bekannten Einzelheiten seines Lebens bis zu dessen abrupter Wende und sein bisheriger Krankheitsverlauf aufgezeichnet waren.
So wusste man, dass der Neue Abitur gemacht, an einer Kunsthochschule studiert und als Maler schon einigen Erfolg gehabt hatte und dann plötzlich, salopp gesagt, verrückt geworden war. Der Akte waren auch einige wenige und schlechte Reproduktionen und Fotografien seiner Bilder vor und nach dem Zusammenbruch angefügt, die des Malers aufgerissene und zerwühlte Seelenlage demonstrieren sollten. Diese Abbildungen waren jedoch nicht nach künstlerischen Gesichtspunkten, sondern nur nach medizinischen begutachtet worden. So fehlte jeglicher Hinweis darauf, dass der wilde und virtuose Malduktus immer schon bestanden und die Krankheit ihn nicht wesentlich verändert hatte. Genau das aber war Direktor Ströhle aufgefallen und hatte ihn neugierig gemacht.
So stellte man sich zwar auf den Neuen ein, ahnte aber nicht im Geringsten, was man sich da eingefangen hatte. Freyenfeld war, wenn er nicht gerade seine Anfälle hatte, ein friedlicher Mensch. Und selbst wenn ihn seine Schrecknisse überfielen, schrie er zwar herum, wurde aber nie aggressiv gegen andere. Gegen sich selber schon. So konnte er sich wild die Fäuste in den Leib schlagen, mit dem Kopf gegen die Wände donnern und sich das fleischige Gesicht zerkratzen. Aber sobald es jemand wagte – und das lernten sie ja dann auch bald –, sich dem Tobenden zu nähern, ihn zu streicheln, ihm sanft zuzureden oder leise Gutenacht und Wiegenlieder zu singen – „Der Mond ist aufgegangen, die güldnen Sternlein prangen“, „Guten Abend, gute Nacht“, „Oh wie wohl ist mir am Abend“, „Guter Mond du gehst so sti-i-lle“, ausgerechnet die, Hattenkerl hatte das herausgefunden – beruhigte er sich schnell und fiel wimmernd in sich zusammen. So gesehen hatten sie ihn gut im Griff.
Nur mit einem kamen sie überhaupt nicht zurecht, da war er unnahbar. Also eigentlich immer.
Es war nicht weiter schlimm, aber doch lästig. Ständig musste man hinter ihm herputzen und aufräumen. Das ging den Müttern und ihren Helferinnen ganz schön auf die Nerven und besserte sich erst, als man die Lösung mit Ludmilla fand.
Wo immer der Pflegling Ludger sich aufhielt, saß, stand oder umherging – malte er. Nein, eigentlich musste man sagen, schmierte, krakelte, klatschte, besudelte er. Alles, was in seine Reichweite gelangte, bearbeitete er so und er war durch nichts, auch nicht durch Gutenacht und Wiegenlieder, davon abzubringen. Kein Geschirr, keine Serviette oder Tischdecke, keine Schranktür oder Wand, auch nicht das kleinste Zettelchen waren vor ihm sicher. Ja, wenn er an nichts anderes herankam, bemalte er sogar sich selbst oder einen schlafenden Mitpflegling. Anfangs besaß er außer ein paar Bunt und Bleistiften nichts anderes und die zerbröselten unter seinen heftigen Strichen immer sehr schnell. Aber bald geriet dem Ludger von Freyenfeld unter den Händen sozusagen alles zur Farbe. So malte oder sudelte er eben mit Kaffee, Senf, Tomatensoße, Spinat, Erde, Kohle, Exkrementen und allem, was er sonst so fand. So hatte er auch als Kleinkind begonnen.
Ströhle allerdings sah sich diese „geniale Schweinerei“, wie er es nannte, nicht lange an. Er ließ eine dicke Rolle Packpapier, massive Zimmermannsstifte, Töpfe mit Acryl und Deckfarben kommen, bettelte sie bei Förderern und Gönnern zusammen, legte auch manchen Euro selber drauf. So gelang es, den Maler einigermaßen auf seinen Tisch zu konzentrieren, wenn auch seine Umgebung trotzdem nicht ganz ungeschoren blieb.
Hans Ströhle staunte. Was da mehr oder weniger in ununterbrochenem Strom unter seinen Augen entstand, war unglaublich. Das war kein ungestaltetes Schmieren und Klatschen mehr, sondern geriffelte, spiralige Flächen, perspektivische Fluchten, grimassierende Köpfe, gefletscht zahnige Münder, wie Fleischwunden aufplatzende Blüten, Baumreihen, die sich in blutrote Himmel krallten, spitzbrüstige Frauengestalten, Füchse, Genitalien, grüne Flaschen, Tod und Teufel. Ein brodelnder Vulkan.
Ströhle staunte und schauderte, lockerte seine Krawattenknoten, wachte nachts schweißgebadet von seinen Albträumen auf, hatte die Vorstellung, dass alles, was je in Fürstenau Furchtbares geschehen war, nun in diesen Bildern ans Licht drängte, erstmals zum Ausdruck kam, aus der Vergangenheit heraus um Anerkennung und Buße schrie. Und ihm war, als ob der Lude Frey einzig zu diesem Zweck und wie ein Rächer nach Fürstenau gekommen sei.
Mit Schrecken fragte er sich, ob er diesem Ansturm gewachsen sei oder ob er nicht doch besser diesen Vulkan zuschütten sollte mit Medikamenten, Überdosierungen, gezieltem Unfall. Als er aber mitten in seinen Fantastereien plötzlich merkte, dass er bereit war, all den Toten einen weiteren hinzuzufügen, sprang er auf, rannte gegen einen Schrank und wurde ohnmächtig. Er kam in Ludmillas Armen wieder zu sich, sah in ihr sogleich den Engel der Versöhnung, rappelte sich hoch, zog seinen Krawattenknoten zurecht, beschloss alles anders zu machen und fühlte sich besser.
Ludger Hyazinth von Freyenfeld bekam sein Nebenzimmer als Atelier und Ludmilla als eine Art „Assistentin“ zugewiesen. Ströhle selbst reiste zur Kunstakademie und zu Professor Sven Spillberk, dessen Meisterschüler sein Maler – er nannte ihn jetzt „mein Maler“ – gewesen war, holte sich dort Rat für Ateliereinrichtung, Farben, Malgründe und erfuhr so manches über seinen Schützling, der, so Professor Spillberk, „hochbegabt, aber immer schon verrückt“ gewesen sei. Er könne sich noch gut erinnern, wie dieser adelige Ludger Katapulte gebaut habe, mit denen er volle Farbeimer in den Wald und in den Himmel geschleudert habe, um diese farbig umzugestalten, oder wie er mit breiten Düngerspraymaschinen über Wiesen gekurvt sei, um große Flächen mit violetten Streifen oder schwarzen Kreisen zu versehen.
Schließlich einigte sich der rührige Direktor mit der Zentrale des „Bundes der Barmherzigen“, dass der Pflegling von Freyenfeld als außergewöhnlicher Künstler und damit geradezu als ebenso positives wie ablenkendes Aushängeschild für das belastete Schloss Fürstenau einen Sonderstatus erhalten und besondere Förderung genießen sollte. So hatte dieser an den Vormittagen in einer betreuten, das hieß bewachten, Montagegruppe zu arbeiten und durfte sich an den Nachmittagen und Abenden ganz seiner Kunst widmen.
Trotz seiner Krankheit, die dem schizophrenen, also dem hirnspaltenden Formenkreis zuzurechnen war und ihn schubweise in diese folternden Zustände warf – die er selber so beschrieb: Er sei dann in einer rasenden Schleuder Stromschlägen ausgesetzt –, war Ludger Hyazinth von Freyenfeld ein kluger Mann. Er konnte offenbar in vielen Dimensionen denken und hatte längst den Tremor potatoris verloren und seine geschickten und ruhigen Zeichnerhände wiedererlangt. So kam es, dass er bald der üblichen einfachen, zusammenschraubenden Arbeiten überdrüssig wurde und man ihn mit immer komplizierteren Tüfteleien betrauen konnte. Dabei bewies er so viel Feingefühl und Fantasie, dass er im Laufe der Zeit zum gut bezahlten Facharbeiter aufstieg. Geld, das man zu seiner künstlerischen Förderung gut gebrauchen konnte. Und zu dieser gehörte auch – und immer deutlicher und schließlich nicht mehr fortzudenken – Ludmilla.
Anfangs hatten ’s Gretle und Adolf, die Hausmutter und der Schlossvater, Anastasia Kolumzik und Hans Ströhle, nur jemanden gesucht, der sich um den Maler und seine „Schmotzereien“ kümmern sollte. Zwar waren jetzt sozusagen Haus und Hof, Bewohner, Hund und Katze, ja Wald und Flur vor dem Lude Frey geschützt, aber in dessen Zimmer und angrenzenden Atelier sah es immer so aus, als seien Farbeimer explodiert. Auch er selber bot keinen viel besseren Anblick und wenn er in seiner Bilderwelt versank, vergaß er schlichtweg zu essen, zu trinken und ins Bett zu gehen und wann ihn seine Zustände übermannten, konnte auch keiner vorhersagen. Er brauchte also in aller Freiheit Aufsicht.
Ludmilla war Polin und auf dem karstig gewellten Kalkgebirge hängengeblieben. Anfangs war sie nach Deutschland gekommen, um Geld zu verdienen. Wenn sie genug zusammenhatte, fuhr sie nach Poznan/Posen, beschenkte ihre Eltern reichlich und kehrte dann zurück ins gelobte Land. Sie arbeitete beim Spargelstechen, als Küchenhilfe, in der Altenpflege und hatte nie die geringsten Schwierigkeiten sich einzuleben und zurechtzufinden. Im Gegenteil. Jedermann freute sich, wenn sie wieder auftauchte. Sie hielt den dicksten Spargel hoch und machte anzügliche Bewegungen, bis die anderen Feldarbeiter breit zu grinsen anfingen, tröstete die türkischen Küchenmädchen, wenn diese wieder einmal über ihre strengen Väter weinten, und heiterte mit ihren putzigen Bemerkungen die alten gebeugt schlurfigen Herren, die sie spazieren führte, so auf, dass diese zum Lachen stehen bleiben mussten.
Auch mit der käuflichen Liebe machte sie flüchtig Bekanntschaft, schrammte gerade so an diesem Arbeitsgebiet vorbei, aber dann machte ihr ein ruhiger ernsthafter Mann einen Antrag und sie folgte ihm in sein Dorf auf der Alb. Ludmilla war die lebenslustigste Person, die man sich vorstellen konnte. Was sie anpackte, gelang, und ihr Lachen hörte man an allen Ecken und Enden.
Das blieb auch ungebrochen so, als der Mann plötzlich starb und sie wieder alleine dastand. Schnell hatte sie sich durch ihre praktische Fröhlichkeit bei den eher verschlossenen Dörflern Freunde und Bekannte erworben und sich da und dort fast unentbehrlich gemacht. Ihr Lachen wirkte ansteckend und forträumend und so schien es kein Problem zu geben, das sie damit nicht lösen konnte. Ludmilla war zweiunddreißig, mollig mit einem runden Gesicht, leicht schräg stehenden Augen und einem schier nicht zu bändigenden Wust schwarzer Haare auf dem Kopf. Wenn sie mit ihrem Fahrrad, auch bei Wind und Wetter, auf das Schloss zugefahren kam, wussten Hausmutter Kolumzik und Schlossvater Ströhle, aber auch alle anderen, die sie kommen sahen, dass nun wieder Leben in die Bude einzog. Kolumzik und Ströhle allerdings auch mit gemischten Gefühlen, denn die ewige Lacherei ging ihnen manchmal auf die Nerven. Und Doktor Liebrecht, der visitierende Psychiater, hatte irgendwann etwas kryptisch angemerkt, man könne auf das Nichts und die gähnende Leere natürlich auch mit schallendem Gelächter reagieren.
Ludmilla war, durchaus nicht nur zur Freude der Mütter in ihren hellgrauen Kleidern mit den dunkleren Umschlägen, schon fast so etwas wie eine Aushilfsinstitution in Fürstenau geworden. Und als man sie fragte, ob sie eine feste Halbtagsstelle zur Betreuung des Pfleglings Ludger Hyazinth von Freyenfeld annehmen würde, waren einige sogar leicht empört: Die sei ja schließlich keine Fachkraft!
Aber Ludmilla lachte nur: Klingt scheen „Hiazint“ und „von“. Werde ich Schlossfreilein!
Man warnte sie durchaus, das sei ein schwieriger Fall. Der Herr „von“ sei ungemein schmutzig, höre innerlich Stimmen und sehe manchmal Bilder und Lichterscheinungen vor sich, sei auch gewalttätig gegen sich selbst. Aber auch da lachte Ludmilla nur: Ich schon weiß. Ich auch höre Stimmen in Zimmer, in Radio und sehe Bilder in Traum, in Fernsehen. Ich nix bleed. Hiazint vielleicht auch nix bleed?
Es war ein Kampf, aber natürlich gewann ihn Ludmilla. Der Herr von Freyenfeld, sie blieb zunächst bei dieser Anrede, auch wenn sich ihr neuer Schützling längst Lude Frey nannte, tobte, schrie, warf mit Tuben und Töpfen, man solle ihn in Ruhe lassen mit dieser „Lachmöwe“. Aber Ludmilla verhielt sich geschickt, lachte weniger oft und laut, schaltete einen Gang zurück, saß hinter geschlossener Tür in des Malers Zimmer, trank Kaffee, strickte, las Zeitung, machte leise sauber. Ihr Herr „von“ rumorte nebenan in seinem Atelier, vergaß sie endlich und sah sie nur noch leicht irritiert an, wenn sie ihm zwischendurch einen Saft oder ein belegtes Brötchen hineinreichte und den erschöpften Mann schließlich nach Vorwarnung ins Bett verfrachtete. Das dauerte alles eine gewisse Zeit, aber so war ungefähr der Ablauf.
Aber es ergab sich auch noch anderes.
Natürlich musste Ludmilla auch dafür sorgen, dass sich ihr Edelmann wusch und duschte. Sie half ihm nicht gerade dabei, aber es ergaben sich doch immer wieder Situationen, dass er ihr nackt oder halbnackt gegenüberstand und sie ihm die Ölfarbenreste mit Verdünnung von Händen, Armen und Gesicht entfernen musste.
Zuerst hatte er sich schämig etwas dagegen gewehrt. Aber bald erlag er der sanften Resolutheit Ludmillas und ließ es mit sich geschehen. Klug hatte die Frau dabei ihr schallendes Lachen auf ein immerwährendes Lächeln herabgedimmt, das ein ganz klein wenig etwas von verschwörerischer Nähe ausdrückte. Eines Tages hatte Ludger zurückgelächelt. Er hatte nie den Direktor „Vater“ oder die verschiedenen Hüterinnen „Mutter“ genannt und als man ihn quasi zwingen wollte, das nun endlich zu tun, hatte er wie außer sich geschrien, eher würde ein fotzmündiger, arschgesichtiger Teufel aus seinem Kopf fahren, als dass er diese Worte ausspräche. Die fülligen Mütter hatten – obgleich protestantisch – vor Schreck und Abscheu das Kreuz geschlagen und ihn nie wieder verbessert, wenn er sie mit Nachnamen anredete.
Ströhle war heilfroh, dass Ludmilla sänftigend auf „seinen“ Maler einwirkte, zahlte ihr aus eigener Tasche Überstunden und ließ in einem Abstellraum grobe Regale bauen, in denen man die schweren Bilder trocknen und aufbewahren konnte, die sonst zusammengeklebt an den Wänden des Ateliers lehnten.
Auch hierbei tobte und schrie Lude, man wolle ihn bestehlen. Aber als man ihm einen Schlüssel gab und ihm den Weg zum Abstellraum einprägte, sodass er jederzeit zu seinen „Kindern“ gehen, sie betrachten oder an ihnen herumverbessern konnte, gab er sich zufrieden. In allem jedoch war Ludmilla die Vermittlerin und Moderatorin und jedermann sah, dass sie zu dem ebenso verschlossenen wie explodierenden Mann den besten Zugang hatte.
Die schweren, farbensprühenden, expressiven Bilder häuften sich. Ströhle plante den nächsten Schritt. Kunstexperten durften heimlich den Abstellraum besuchen, waren durchweg erschüttert und begeistert und drängten auf Veröffentlichung. Und gerade da erlitt Lude Frey seinen bisher schlimmsten Schub. Er schrie in den höchsten Tönen unverständliches Zeug und fuhrwerkte in seinem Malraum derart herum, dass man meinte, er bräche sogleich durch die Wände.
Dieses Mal wagte selbst Ludmilla im Nebenraum nicht, dem Tobenden in die Arme zu fallen, und lief nach Hilfe.
’S Gretle, Adolf, die Kerl und der Hammer waren sogleich zur Stelle. Eine Spritze wurde, zum ersten Mal wieder nach langer Zeit, aufgezogen und als das Splittern und Krachen, das Bersten und Knallen hinter der Tür sich eher noch steigerten, stürmten sie das Zimmer und warfen sich auf den Mann. Der war nackt, hatte eine Binde vor den Augen und war von Kopf bis Fuß so mit Farbe beschmiert, dass er eher einem Kunstobjekt als einem Menschen glich. Der Vogt, dieser Dürrling mit den Schraubstockhänden, packte ihn sofort, wurde aber wie ein lästiges Stück Holz von dem Tobenden herumgeschleudert, bis er mit einer Hand den Heizkörper zu fassen bekam, und weil er mit der anderen den Maler nicht losließ, diesen wenigstens fixieren konnte. Ströhle klammerte sich an den unteren Teil des Mannes, wobei sein schöner zweireihiger Anzug völlig ruiniert wurde, die Kerl knallte sich mit ihrem voluminösen Hinterteil auf Brust und Gesicht dieses konvulsivisch sich windenden Fleischberges und ’s Gretle hieb ihre Spritze irgendwo dort hinein.
Es dauerte eine Weile, doch dann erschlaffte der wilde Mann.
Ludmilla löste die festgeknotete Augenbinde, sah die wegkippenden, halb besinnungslos durcheinanderrutschenden Verzweiflungsblicke, kämpfte mit den Tränen und sagte zum ersten Mal beschwörend leise: Hülu! Hüüülu!
Das Atelier sah aus wie ein Schlachtfeld. Das meiste war kurz und klein geschlagen, Farben bis an die Decke gespritzt. Trotzdem konnte man aus Resten und Spuren rekonstruieren, dass sich der Maler offenbar nackt ausgezogen und sich die Augen fest verbunden hatte. Dann war er vermutlich auf eine große mit dicken blauen, weißen und schwarzen Ölfarbhaufen versehene Leinwand gekrochen und hatte diese sozusagen blindlings mit seinem ganzen Körper bearbeitet. Ob er dabei – quasi zufällig – in diesen Tobsuchtsanfall geraten war, ob ihn der plötzliche Ganzkörperkontakt mit diesen glitschigen, zähen Massen an Fürchterliches erinnert hatte oder ob die Zerstörungsorgie in einem simulierten Außersichsein Teil einer inszenierten Aktion war, konnte niemand sagen.
Auch Doktor Liebrecht nicht, der zwar mit seinem Geländewagen umgehend aus der Kreisstadt losgefahren war, aber doch über eine Stunde bis Fürstenau gebraucht hatte. Nun fand er nur noch das erschreckend bunt demolierte Atelier vor und, in seinem Zimmer in eine alte Decke gehüllt, den schlafenden Titan. Zwar entschlüpften dem Doktor doch die Worte „herrlich“ und „pittoresk“, aber dann setzte er schnell eine ernste Miene auf, sagte, man müsse das Ganze aus forensischen und wissenschaftlichen Gründen genau dokumentieren, und wünschte, dass man den schlafenden Kranken auswickeln und zwischen die zerstörten Gegenstände in das verschmierte Atelier legen möge. Ludmilla erregte sich sogleich: Das nix gutt! Und auch Ströhle wollte seinen Maler nicht so hässlich dekoriert sehen. Aber der Psychiater und praktische Arzt setzte sich geschickt mit dem Argument durch, eine solche Fotoserie würde dem Ruhm seines Schützlings sicher keinen Abbruch tun.
Also schleppte man den schlafenden Lude Frey zurück ins Atelier, lehnte ihn nackt und voller Farbe an den Heizkörper, band ihm die Augenbinde wieder vor, drückte ihm ein paar Trümmer, Leisten, Leinwandfetzen in die Hand und dann schoss Doktor Liebrecht aus allen Rohren. Tatsächlich entstand so eine Fotoserie, die, arrangiert und veröffentlicht, später noch für einiges Aufsehen sorgen sollte.