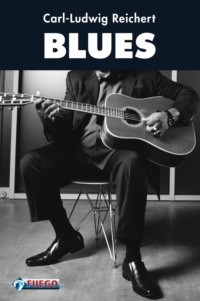Buch lesen: "Blues"
Carl-Ludwig Reichert
Blues
Geschichte und Geschichten
FUEGO
– Über dieses Buch –
Traurig und heiter im Sound, mitreißend und verführerisch im Rhythmus, ironisch, unsentimental und alltagsnah im Text – das war der Blues, als er von den Afroamerikanern erfunden wurde. Er wurde zur Basis für Jazz, Rock'n'Roll und alles, was später kam. Eine unterhaltsame und informative Geschichte des Blues, die es so selbst in seinem Mutterland noch nicht gibt.
Der Legende nach schließt jeder wirkliche Blues-Musiker an einer ganz bestimmten Kreuzung im Mississippi-Delta einen Pakt mit dem Teufel. Sonst bleiben musikalische Kreativität und Erfolg im Geschäft und in der Liebe aus. Wer aber die Höllenhunde des Blues auf seinen Fersen hatte, wie der legendäre Robert Johnson, dem noch die Rolling Stones einen ihrer größten Hits, ›Love in Vain‹, verdanken, den konnte schließlich nur ein eifersüchtiger Ehemann mit vergiftetem Whisky stoppen. Von dieser »devil's music«, die brave Gospel-Mädchen nicht singen durften und von der gläubige Mütter ihre Söhne – vergeblich – fernzuhalten versuchten, ist hier die Rede.
Der Autor, ein profunder Kenner, versteht es, aus der Geschichte des Blues und seiner Interpreten von den Anfängen bis zu den jüngsten Revivalbewegungen mit all ihren Kreuz- und Querverbindungen heraus die subtile und sublime Qualität dieser Musik anschaulich zu machen und auch beim Lesen zum Klingen zu bringen.
Einleitung: Blues – die Mutter (fast) aller Pop-Musik
Der Blues ist das Einfache. Deshalb ist er so schwer. Man kann ihn auf nur einer Saite spielen, wie Lonnie Pitchford, auf der Gitarre wie Robert Johnson oder Jimi Hendrix, dem Piano wie Pinetop Perkins oder Memphis Slim, allein wie Blind Blake oder Corey Harris, mit anderen wie die Memphis Jug Band oder The North Mississippi Allstars, sogar als voll instrumentiertes Orchester wie bei W.C. Handy oder Andy Kirk & His Clouds Of Joy – er bleibt immer erkennbar, gebunden an das wenig variable Schema der zwölf Takte, der drei, höchstens vier grundsätzlichen Harmoniewechsel der Akkordstufen I, IV, V, (IV) und I1 – und der Blue Notes, jenen zwischen den Tonarten schwebenden unkorrekten, aber unendlich aufregenden Zwischentönen, die ihn charakterisieren. Es gibt freilich immer wieder Ausnahmebluesmusiker, die sich nicht einmal daran halten. Doch ob sie nun acht, elf oder sechzehn Takte spielen oder in nur einer Harmonie – am Feeling, am einfühlsamen Spiel und an den Blue Notes wird man den Bluescharakter immer erkennen.
Seinen ohnehin vorhandenen Hang zum Metaphysischen drückt am Besten die bekannte Legende von der geheimnisvollen Kreuzung aus, zu der sich der noch unvollendete Bluessänger begeben muss. Dort wartet er, mit der Gitarre in der Hand, bis aus dem Nichts eine dunkle Gestalt hinter ihm auftaucht. Er dreht sich nicht um, auch nicht, wenn die Gestalt ihm die Gitarre aus der Hand nimmt, sie stimmt, ein paar komplizierte Bluesriffs darauf spielt und sie ihm wieder zurückgibt. Damit ist der Teufelspakt geschlossen und von nun an kann der Sänger den Blues vollendet auf der Gitarre begleiten – wie Robert Johnson oder all die anderen, denen man nachsagte, einen solchen Pakt eingegangen zu sein.
Rein musikalisch gesehen ist der Blues zunächst geradezu simpel und schematisch. Das macht es so schwer, ihn einfallsreich und interessant zu spielen. Denn dazu ist dann schon wieder eine erhebliche Virtuosität innerhalb des Genres nötig, wie die Einspielungen der Meister zeigen: ausgefeilte Pickingtechnik, Experimente mit offenen Gitarrenstimmungen, Übernahme von Einflüssen anderer Musikstile wie Gospel, Ragtime oder Techniken wie das Sliden, der Walking-Bass oder das Boogie-Ostinato in unendlichen Variationen.
Allerdings: Der Blues ist viel mehr als einfach nur ein Musikgenre und entzieht sich somit erfolgreich der grauen Theorie. Man hat ihn. Man singt und spielt ihn oder man hört dem zu, der ihn singt und spielt. Manche leben ihn, freiwillig oder unfreiwillig. Er ist Singular und Plural in einem – The blues got me und I got these blues. Er ist die Basis aller angloamerikanischen populären Musik, die sich nicht direkt aus der europäischen Folklore ableiten lässt. Er hat Geschwister in Afrika, Brasilien und Hawaii und er hatte ein Baby, das nannte man Rock 'n' Roll. Keine illustre Verwandtschaft, aber ehrliche Leute.
Viele seiner Abkömmlinge gingen ins Showbusiness: Boogie, Rhythm & Blues, Dixieland, Skiffle, Bluesrock. Einige studierten und wurden Intellektuelle: Jazz, Free Jazz. Andere zogen in die Metropolen und modernisierten ihn: Soul, Hip-Hop, Rap. Inzwischen taucht er manchmal sogar als Sample bei Moby oder in Technostücken auf. Wenn B.B. King und Eric Clapton ihn zusammenspielen, kauft ein Millionenpublikum das Album. Egal, was Puristen, Leute mit Geschmack, Kenner oder Fans davon halten. Vielleicht einfach nur, damit man ihn nachhaltig wahrnimmt, auch im einundzwanzigsten Jahrhundert.
Dessen definitiver Bluessänger stand freilich schon im späten Zwanzigsten fest: Captain Beefheart alias Don Van Vliet.
Als freilich damals in den Sechzigern ebenfalls Millionen eine Single der Rolling Stones mit dem Titel »Love in Vain« hören wollten, ahnte kaum jemand, dass es sich um einen Blues von Robert Johnson, dem großartigen Sänger und Gitarristen aus dem Mississippidelta handelte. Erst als Mitte der Neunziger Jahre ein weiteres, bis heute andauerndes Bluesrevival einsetzte, das sich insbesondere auf die archivalischen Schätze des Vorkriegsblues richtete, wurde zur allgemeinen Überraschung eine Gesamtaufnahme der Bluesklassiker von Robert Johnson über eine halbe Million mal verkauft. Pop als Blues? Blues als Pop? Einmal so, einmal anders?
Fragen, die nur mit einem deutlichen »Jein« beantwortet werden können. Denn wie das Wort »Pop« auch – das einerseits eine Abkürzung für Popular Culture ist und den gesamten Bereich populärer Vergnügungen umfasst, andererseits aber einfach Popular Music von der Heimatschnulze bis zur Noise-Avantgarde bedeutet – war der Begriff »Blues« von Anfang an mit einer Doppelbedeutung behaftet. Schuld daran war kein geringerer als sein angeblicher Vater W.C. Handy (1873 – 1958) selbst.
Dessen für Tanzkapellen komponierte Stücke, die er auf den Straßen von Memphis adaptiert, als Notenblätter veröffentlicht und als Blues betitelt hatte, lösten nämlich die erste Blueswelle in Amerika aus. Blues war hier analog zu Bezeichnungen wie Charleston oder Shimmy der Name für eine bestimmte Art von Tanzmusik, die mehr oder weniger nach dem Bluesschema funktionierte. Eher weniger, denn schon in seinen Riesenhit »St. Louis Blues« schrieb Handy abwechslungshalber eine Einleitung im Tangorhythmus hinein.
Von welchen Bluesarten soll also in der Folge die Rede sein? Vom Tanzblues, vom Bluestanz, vom Landeierblues oder von dem der Stadtstreuner, vom Blues im Bordell oder vom Revivalblues im Hörsaal oder Stadttheater? Lassen wir Experten sprechen, denn die blicken auch nicht ganz durch.
»Der Blues als eigenständige musikalische Form ist wahrscheinlich in den Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, doch der Stil und die ›Bluesstimmung‹ waren schon seit über hundertfünfzig Jahren Bestandteil der Musik der nordamerikanischen Neger. Ein Blues ist ein tiefempfundener Song von ganz persönlicher, gefühlsbestimmter Eigenart. Im Blues fanden die Gefühle der Negersänger in allen Teilen des amerikanischen Südens ihren Niederschlag, und als sich die regellose Vielfalt der Plantagenlieder langsam in lose Muster ordnete, wurde der Blues zu einem Teil des Negerlebens selbst.« So romantisierend und gefühlig konnte Samuel B. Charters noch in den 1950er Jahren schreiben, als er sein bis heute unverzichtbares Standardwerk Country Blues verfasste. Einen scharfen, witzigen Verstand, Showmanship und geschäftliches Kalkül wollte er seinen Protagonisten nicht so gern zuschreiben.
Auch Giles Oakley wandelte 1976 auf dem Pilgerpfad der großen Gefühle. Aber er sah schon mehr: »Für diejenigen, die versuchten, eine geordnete Frömmigkeit, eine anerkannte, allgemeingültige Handlungsnorm im Leben aufrechtzuerhalten, die wenigstens im Tod noch Freiheit bringen würde, war es die Musik des Teufels ... Aber für die, die ihn sangen und ihn auch heute noch singen, ist er eine Musik des Gefühls, der direkten Beobachtung und des Feststellens von dem, was ist, und nicht, was sein könnte, unverziert, unvollkommen und ohne Ansprüche.«
Davor schon hatte der Franzose Hugues Panassié charakteristische Züge von Bluestexten festgestellt: »Die Texte des Blues – die sich der Sänger oft selber ausdenkt – spiegeln die Lebenseinstellung der Schwarzen wider: Auf eine Melodie mit dramatischem Akzent werden häufig komische, humorvolle Texte gesungen; und mitunter begleiten dramatische Texte voll bitterer Wahrheit eine heitere Melodie.«
Der Blues, wie gesagt, ist schwer zu fassen. Nimmt man ihn zu eng, rutscht er zwischen den Fingern durch, definiert man ihn zu breit, landet man bei Sprüchen wie »Ois is Blues«, legt man ihn einseitig auf Gefühl, Protest oder Unterhaltung fest, macht er sich aus dem Staub. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Blues eine besondere Haltung der Musik, der Welt, Gott und Teufel, den Mitmenschen und sich selbst gegenüber. Er definierte sich dann bei jedem einzelnen seiner Interpreten auf ganz besondere, eigenartige, individuelle Art. Ich werde deswegen keine eigene, nur scheinbar objektive Definition des Blues versuchen, sondern verschiedene prägnante Aussagen von Bluesmusikern zitieren, die in ihrer Gesamtheit eine Ahnung von der existentiellen Dimension des Blues ermöglichen. Hier sind einige davon. Die Schockierendsten gleich zu Beginn.
Lead Belly in der Einleitung zu »Good Morning Blues«:
»Now, this is the blues. Never the white man had the blues, 'cause nothing to worry about. Now you lay down at night. You roll from one side of the bed to the other all night long. You can't sleep. What's the matter? The blues has got ya! You git up and sit on your side of your bed in the morning, may have a sister and a brother, a mother and father around, but you don't want no talk out of them. What's the matter? The blues got ya! When you go and put your feet under the table, look down at your plate, got everything you wanna eat. With your shaky head you get up and you say: Lord, I can't eat, I can't drink. What's the matter? The blues got ya! Wanna talk to ya. Hear, what you got to tell em:
Good morning blues, blues how do you do?
Good morning blues, blues how do you do?
I'm dyin allright, good morning, how are you?« 2
Schlechte Zeiten für weiße, angelsächsische Protestanten schon damals. Denn selbst den Blues zu haben, sprach ihnen einer wie Lead Belly, den sie aus dem Gefängnis gelassen hatten, um sein Repertoire von über fünfhundert Songs anzuzapfen und um sich in den Konzerten beim Anblick des ungeschlachten Mordbuben mit seiner Zwölfsaitigen gepflegt zu gruseln, glatt ab. Und jüngst setzte David Honeyboy Edwards in seiner Autobiographie The World Don't Owe Me Nothing noch eins drauf: »Because they're white, white musicians, when they play blues, they get the benefit of our music. They get more recognition for our music than we do. But then it makes blues more popular, too. I think a few different ways about it ... A lot of these white boys play the blues real good. Ain't but one thing about most of them though: most can't sing a thing.3« (HBE, S.196)
Alles klar? Von wegen. So schwarz, wie der Blues gern wäre, ist er nämlich vielleicht gar nicht. So, wie David Honeyboy Edwards selbst einen Schuss Indianerblut in seinen Adern hat, so multikulturell sind die Einflüsse, denen er entsprang: Afrikanisches sowieso, aber auch die Slide-Technik aus Hawaii, aus den Alpen und den Prärien die Jodler und wer etwa die Musik der brasilianischen Cangaceiros mit offenen Ohren hört, weiß auch nicht so recht, wer was von wem hat. Mit Sicherheit ist der Blues nicht von heute auf morgen als fertige Sing- und Spielweise entstanden, sondern über lange Zeiträume hin und unter spezifischen sozialen und kulturellen Bedingungen.
Houston A. Baker Jr. beschrieb das in seiner unter Musikern viel zu wenig bekannten Untersuchung Blues, Ideology, and Afro-American Literature – A Vernacular Theory: »Die Blues sind eine Synthese ... Sie vereinigen Worksongs, weltlichen Gruppengesang, Field Hollers, geistliche Harmonien, sprichwörtliche Weisheiten, volkstümliche Philosophie, politische Kommentare, schlüpfrigen Humor, elegische Klagen und noch viel mehr, sie stellen ein Gemisch dar, das in Amerika immer in Bewegung gewesen zu sein scheint – und das die besonderen Erfahrungen von Afrikanern in der Neuen Welt ständig ausgebildet, geformt, verformt und durch neue ersetzt hat.« (Baker, S. 5)
Der Blues ist der entscheidende Beitrag der schwarzen Bevölkerung zur amerikanischen (Musik-)Kultur. Er ist zudem, um mit Baker zu sprechen, die Matrix afroamerikanischen Lebens überhaupt. »Die Matrix ist ein Punkt ständigen Inputs und Outputs, ein Netz aus einander überlagernden und sich kreuzenden Impulsen, die sich immer auf produktive Weise voran bewegen. Afroamerikanische Blues stellen solch ein vibrierendes Netzwerk dar.« (Baker, S. 4)
Genau auf diese Weise überlagern und ergänzen sich die individuellen Definitionen der Bluesinterpreten. Sie alle befinden sich innerhalb der Bluesmatrix.
Booker (Bukka) T. White: »The foundation of the blues is working behind a mule way back in slavery time.«4 (Oakley, Devil's Music S. 7).
Champion Jack Dupree: »You got a good woman and lose her, that's the beginning of the blues...«5 (Zum Autor, auf die Frage, was denn der Blues für ihn sei.)
Lightnin' Hopkins: »See, that's the blues- take your worry and twist it into a little story. Don't mean the worry goes away. It's like Mama putting an ointment after the bee bites you – takes away the terrible sting.«6
Willie Dixon: »The delivering of messages in a song is the blues, but today, people don't look into the song to get information. they just sing the the song for the musical qualitiy or rhythm quality and they never get the actual reason of the song. People have lost the original blues and the blues itself by the other creations that surround it. That's the reason I always say about music, the blues are the roots and the other musics are the fruits. Without the roots, you have no fruits so it's better keeping the roots alive because it means better fruits from now on. That's why I say the blues will always be because the blues are the roots of American music.«7
Sam Chatmon: »You know the blues partly come out of New Orleans and jazz, too. And they brought the blues down from church songs. And I'll tell you why the blues come about. It's a expression that a person have – he want to tell you something, and he can't tell you in his words, he'll sing it to you ...«8 (Sallis, The Guitar Players 1982)
Wenn man den Blues unter Respektierung seiner vielfachen Wurzeln individualisiert, wird klar, dass eine Bluesfrau und ein Bluesmann nur sein konnte, wer ihn entweder selbst erfand oder ihn sich durch kongeniale Interpretation aneignete und weiterentwickelte. Ob das im textlichen oder instrumentalen Bereich war, spielte dann kaum eine Rolle. Dass freilich dem Sänger und Interpreten in Personalunion der meiste Respekt gebührt, steht für mich und damit in diesem Buch außer Zweifel. Es sind die archaisch-anarchischen, fast mythischen Gestalten der Sängerinnen und Sänger aus der immer besser erforschten Frühzeit des Blues, denen besondere Beachtung gebührt, allen voran der dämonische Robert Johnson, aber auch die derbe Ma Rainey, die kaiserliche Bessie Smith, der kompakte Charlie Patton, der elegante Lonnie Johnson, der schlüpfrige Tampa Red oder der fingerfertige Blind Blake, um nur einige zu nennen. Damit ist nichts gegen rein reproduzierende Musiker und Interpreten gesagt, sie werden aber in dieser Darstellung nur eine Nebenrolle spielen.
Die Hauptrolle spielt ohnehin der Blues selbst. Denn er war und ist spätestens seit der letzten Jahrhundertwende die Basis der gesamten modernen amerikanischen Unterhaltungsmusik, vom Jazz bis zum Rock 'n' Roll, vom Schlager bis zum Musical. Obwohl seine Ursprünge nach wie vor im Dunkeln liegen und die Forschung inzwischen afrikanische Einflüsse (etwa aus Mali) stärker einbezieht, wird der Blues erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts als eine Musikform greifbar, die die Gesamtheit der Erfahrungen und Gefühlsregungen schwarzer Menschen ausdrücken konnte. Zwei Hauptformen sind zu unterscheiden:
a) der städtische Blues, der in den dortigen Vergnügungsvierteln entstand und als Vaudeville-Blues meist von einer Jazzband mit einer Sängerin vorgetragen, bald auch von der Plattenindustrie auf sogenannten Race Records speziell für den schwarzen Markt produziert und verkauft oder von Einzelunterhaltern und kleinen Gruppen in Kneipen und Bordellen dargeboten wurde. Zentren waren u.a. Chicago, Kansas City, St. Louis, Dallas, Memphis und New Orleans.
b) der ländliche Blues, heute auch gern Downhome-Blues genannt, der von vagabundierenden Einzelsängern, Duos, String- oder Jugbands erfunden, professionell gegen Entgelt aufgeführt und auch schon sehr bald in kommerziellen Sessions von Talentsuchern der Plattenfirmen mitgeschnitten und auf den Markt gebracht wurde – ein Umstand, dem wir die günstige dokumentarische Lage für den älteren Blues verdanken. Er wurde aber wohl auch als privates Freizeitvergnügen praktiziert, zumindest bis zu dem Tag, an dem ein Folkloreforscher mit Aufnahmegerät vor der Tür stand ...
Entgegen der landläufigen Tanzmusik-Definition sind die Blues weder notwendigerweise langsam noch traurig. Sie umfassen das gesamte Spektrum menschlicher Lebensäußerungen, Freude, Trauer, Liebe, Hass, Witz, Ernst, Tragik, Komik, Lust und Leid. Eine Besonderheit der Texte ist in vielen Fällen ihre Doppeldeutigkeit, der sog. Double Talk, nicht nur im erotisch-sexuellen Bereich, sondern auch im politischen. Es war dies mit Sicherheit eine Selbstschutzstrategie, um nicht mit den jeweiligen Obrigkeiten in Konflikt zu geraten. Es muss in diesem Zusammenhang auch betont werden, dass der Blues weit unter- und außerhalb der bürgerlichen weißen und, soweit vorhanden, schwarzen Gesellschaftsschichten angesiedelt war, vor allem in der Zeit der Prohibition. Freilich erregte er gerade dadurch das Interesse junger, nicht konformer Weißer, die sich zunächst für die Musik begeisterten, bald aber auch den Lebensstil der schwarzen Protagonisten kopierten – bis heute.
Was die meisten Fans in ihrem Enthusiasmus freilich vergessen, ist, dass der Blues von individuellen Erfahrungen handelt, die einer Gemeinde von Eingeweihten mitgeteilt werden. Man kann die Musik zwar bis ins letzte Detail kopieren und spielen lernen, aber, wie der Deltabluesmusiker David Honeyboy Edwards oben lakonisch anmerkte, »sobald sie [die jungen weißen Bluesmusiker] den Mund aufmachen, ist der Ofen aus«. Edwards meinte junge Amerikaner, wohlgemerkt. Was er von dem urigen Mississippi-Denglisch-Geknödel hiesiger Muddy-Waters-Imitatoren halten würde, mag man sich lieber nicht vorstellen.
Die Bluesforschung in den USA ist in mehreren Wellen erfolgt. Pionieren wie John A. Lomax und seinem Sohn Alan, die im Kontext der Folksongs, der Cowboy-Folklore und der Gospelsongs den Blues entdeckt hatten und ihn vor allem in den Gefängnissen der Südstaaten sammelten, taten es in den Sechziger Jahren junge Enthusiasten nach, die sich auf die Spuren legendärer Sänger wie etwa Robert Johnson setzten, viele Überlebende ausfindig machten und neu aufnahmen. Seither werden verstärkt die regionalen Varianten des Blues untersucht, also etwa der Texas-Blues, der Piedmont-Blues, der Red-River-Blues u.v.a. In jüngster Zeit hat sich die feministische Forschung umfänglich mit den widerständigen Inhalten der Vaudeville-Blues von Sängerinnen wie Alberta Hunter, Bessie Smith, Ma Rainey oder Victoria Spivey beschäftigt und den Subtexten von Gewalt, lesbischer Sexualität und weiblichen Gegenstrategien zum Patriarchat der weißen wie der schwarzen Bosse nachgespürt.
Das Material dazu lieferten die wieder geöffneten Archive der privaten und öffentlichen Sammlungen, die dank der neuen Technologien der Digitalisierung und Entrauschung ein fast verschüttetes Erbe wieder gut hörbar machten. Der Erfolg der Robert-Johnson-Edition trug sicher ebenfalls dazu bei, dass seit 1995 die Bluessongs aus der Schellack-Epoche der Zwanziger bis Fünfziger Jahre wieder auf CD-Alben erhältlich sind. Die meisten sind zudem liebevoll und kompetent ediert.
Die Rezeption dieser Musik war zur Zeit ihres Entstehens in Deutschland kaum möglich. Die Race Records wurden nicht exportiert, alles Weitere verhinderte die Nazibarbarei. Deshalb ist bei uns die Vorstellung vom Blues immer noch stark geprägt von den Bluesinterpreten der Nachkriegszeit, insbesondere vom Chicago-Blues und von der amerikanischen Folksong-Bewegung um Pete Seeger, die eine puristische, dem Kunstlied zuneigende Interpretation traditioneller Songs für besonders authentisch hielt. Da Sänger wie Big Bill Broonzy, Josh White oder Dave van Ronk sich dieser Forderung des weißen Geschmacks in den Fünfziger Jahren anpassten, wurden sie zeitweise immens populär, verhinderten aber lange Zeit die Rezeption bodenständigerer Bluesmusiker von Slim Harpo bis Howlin' Wolf.
Auch der Rhythm & Blues wurde hierzulande fast ausgelassen, dem Dixieland-Revival der Dutch Swing College Band und Chris Barbers folgte gleich der Rock 'n' Roll eines Elvis Presley und des abtrünnigen Bluesmanns Chuck Berry, der es auf kleine weiße Mädels abgesehen hatte. Die Skiffle-Bewegung, eine Simplifizierung der Jugband-Musik, war ein spezifisch englisches Phänomen, für das im Wesentlichen der Name Lonnie Donegan stand und steht.
So stand einer akademisch-idealistisch-puristischen Jazzgemeinde europaweit ein kleines, ebenfalls zu jedweder Dogmatik neigendes Häuflein von Bluesenthusiasten gegenüber, das erhebliche Informationsdefizite aufwies. Manche davon wirken sich bis heute aus. Es ist daher die Absicht dieser Darstellung, einige Akzente anders zu setzen als bisher üblich.