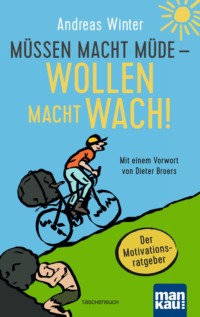Buch lesen: "Müssen macht müde - Wollen macht wach!"
Andreas Winter
Müssen macht müde –
Wollen macht wach!
Der Motivationsratgeber
Haben Sie Fragen an Andreas Winter?
Anregungen zum Buch?
Erfahrungen, die Sie mit anderen teilen möchten?
Nutzen Sie unser Internetforum:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Andreas Winter
Müssen macht müde – Wollen macht wach!
Der Motivationsratgeber
E-Book (epub): ISBN 978-3-86374-444-1
(Druckausgabe: ISBN 978-3-86374-442-7, 1. Auflage 2017)
Mankau Verlag GmbH
D-82418 Murnau a. Staffelsee
Im Netz: www.mankau-verlag.de
Internetforum: www.mankau-verlag.de/forum
Lektorat: Josef K. Pöllath, Dachau
Endkorrektorat: Susanne Langer M. A., Germering
Umschlag: Andrea Barth, Guter Punkt GmbH & Co. KG, München
Gestaltung Innenteil: Mankau Verlag GmbH
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Illustration Cover: Kilta Angela Kuchenmüller, Böblingen Illustrationen Innenteil: Can Stock Photo / Lonely11 (8); Can Stock Photo / Choreograph (14/15); Can Stock Photo / ra2studio (36/37); Can Stock Photo / racorn (44/45); Can Stock Photo / EpicStockMedia (54/55); Can Stock Photo / SergeyNivens (66/67); Can Stock Photo / dotshock (76/77); Can Stock Photo / dolgachov (98/99); Colourbox.de (112); Can Stock Photo / aikidoki (116/117)
Energ. Beratung: Gerhard Albustin, Raum & Form, Winhöring
Wichtiger Hinweis des Verlags:
Der Autor hat bei der Erstellung dieses Buches Informationen und Ratschläge mit Sorgfalt recherchiert und geprüft, dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr; Verlag und Autor können keinerlei Haftung für etwaige Schäden oder Nachteile übernehmen, die sich aus der praktischen Umsetzung der in diesem Buch dargestellten Inhalte ergeben. Bitte respektieren Sie die Grenzen der Selbstbehandlung, und suchen Sie bei Erkrankungen einen erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker auf.
ACHTUNG:
DIESES BUCH DIENT NICHT
DER UNTERHALTUNG ODER
LEICHTEN LEKTÜRE.
ES IST EIN RATGEBER,
DER IHR LEBEN RADIKAL
VERÄNDERN KANN!
Inhalt
Vorwort von Dieter Broers
Vorwort des Autors
Das Geheimnis natürlicher Muntermacher
Was programmiert die innere Uhr?
Der Unterschied zwischen Ruhe und Erholung
Kurzschlaf-Techniken
Das schlaflose Gehirn
Lernen müssen macht müde
Lernen und Fühlen im Mutterleib
Reize: Grundvoraussetzung fürs Denken
Der Unterschied zwischen Gedanken und Gefühlen
Der Unterschied zwischen Müssen und Wollen
Arbeiten wie im Urlaub
Die Einstellung macht’s
Die Lebensqualität steigern
Sonne, Vitamin D3 und der Wunsch nach Freiheit
Der perfekte Wecker für Morgenmuffel
Der Algorithmus der Psyche
Formel für den Sinn des Lebens
Wenn Sie wüssten …!
Warum müssen wir müssen?
Verantwortung statt Schuld
Emotionale Störungen
Der Einfluss der Religionen
Müssen – Blasendruck ist stressbedingt
Müssen macht impotent
Der Geistesblitz auf dem Klo
So stellen Sie Ihr Gehirn auf Erreichen ein!
Das Wunder des (unter-)bewussten Erfolgs
Die Geldformel
Sie sind bereits Millionär
Schlusswort
Anhang
Niemals arbeiten müssen
Danke
Anmerkungen
Ausbildung zum Gesundheitsberater
Zum Autor
Weitere Bücher von Andreas Winter
Audio-CDs von Andreas Winter
DVDs von Andreas Winter
Stichwortregister

Vorwort von
Dieter Broers
Ich begegnete Andreas Winter zum ersten Mal im Oktober 2017 in Regen. Regen ist ein kleiner Ort in Niederbayern, in dem sich einige Hundert Freidenker mehrmals im Jahr treffen. Zu diesen sogenannten Regentreffs hat mich Oliver Gerschitz, der Veranstalter und Inhaber des OSIRIS Verlags schon mehrfach eingeladen, und ich freue mich immer, dabei alte Freunde zu treffen. Ich wusste nicht, wer Andreas Winter ist, als er auf die Bühne trat. Er war sichtlich aufgeregt, als er zu sprechen begann, aber es nahm ihm nichts von seiner Überzeugungskraft. Er sprach frei, ohne Manuskript und Power-Point-Präsentation, und zog das Publikum in den Bann. Schlüssiger und unterhaltsamer hatte ich schon lange keinen Redner mehr erlebt. Andreas Winters Gedanken und Schlussfolgerungen waren zwingend, und am Ende war das Publikum bereichert und motiviert.
Dabei hat Andreas Winter einfach nur von Dingen gesprochen, die auf der Hand liegen, die aber niemand so ernst nimmt, wie man sie nehmen sollte. Es sind die Dinge, die wir bisher immer alle einfach hingenommen haben, ohne sie zu hinterfragen. Und so geht es auch in diesem Buch um ein Thema, das uns alle angeht und zu dem wir uns verhalten müssen.
Die Veränderungen, die gegenwärtig auf dieser Welt vor unser aller Augen stattfinden, sind von einer überwältigenden Dimension. Schon sehr bald wird so vieles so gewaltig anders sein, als es bisher war, dass viele nicht mehr mitkommen werden. Was wir bei dieser Entwicklung nicht vergessen dürfen, ist, dass wir es selbst waren bzw. sind, die diese Veränderungen wollten, weil wir alle nicht mehr Müssen wollen.
Ich lege Ihnen das vorliegende Buch von Andreas Winter daher ans Herz. Er wird Sie davon überzeugen, dass es in Ihrer Macht liegt, Ihr Leben in die Hand zu nehmen und selbst zu gestalten, welches Stück auf der Bühne Ihres Daseins als Nächstes auf dem Spielplan steht.
Dabei wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und Andreas Winter den Erfolg, den er verdient!
Unterlembach, im Dezember 2017
Dieter Broers
Vorwort des
Autors
„Du musst nur wollen!“ – Diesen zynischen Rat hören viele, die sich mit den alltäglichen Pflichten, unliebsamen Aufgaben oder großen, unvermeidlichen Herausforderungen herumplagen. Aber wie soll man etwas wollen, das einen förmlich nach unten zieht? Ist der Spruch nicht eine glatte Verhöhnung derjenigen, die unter dem steigenden Druck von Arbeit, Haushaltspflichten und Alltagserwartungen leiden? Motivationsbücher gibt es wie Sand am Meer, und die Branche der „Tschakka-Gurus“ boomt.
Doch Hand aufs Herz: Gehen Sie zu einer Massenveranstaltung, bei der ein hoch bezahlter Turnschuh im grauen Anzug auf einer Bühne herumspringt, nur weil Sie sich einfach nicht dazu aufraffen können, endlich einmal Ihre Garage aufzuräumen? In welchem Buch steht denn, wie Sie es schaffen, ohne Protest-Zigarette den Abwasch zu erledigen oder mit dem Hund rauszugehen? Was ist, wenn Ihre Partnerin seit Monaten darauf drängt, dass Sie den Rasen mähen oder den tropfenden Wasserhahn reparieren? Oder Sie nach der Arbeit einfach wie erschlagen auf dem Sofa landen? Was ist, wenn die Stunden der Nachtruhe einfach nicht ausreichen, um frisch und erholt ans Tagewerk zu gehen? Wenn Sie ohne eine Flasche Wein oder eine Handvoll Schlaftabletten nicht einschlafen und ohne einen Pott schwarzen Kaffee, mit dem man die Straße teeren könnte, nicht aufwachen können? Vielleicht halten Sie sich für faul und undiszipliniert, schämen sich dafür, dass Sie nicht belastbar sind, und spielen ernsthaft mit dem Gedanken, nach Timbuktu oder Kiribati auszuwandern? Dann stimmt doch mit Ihnen eigentlich etwas nicht, oder?
Doch liegt der Fehler wirklich immer bei Ihnen, oder kann es sein, dass noch ganz andere Einflüsse in Ihrem Nervenkostüm am Werk sind? Schließlich sind Sie sicher nicht der Einzige, der darunter leidet, etwas zu müssen, zu sollen und nicht zu dürfen oder zu wollen. Das Gefühl von Pflicht, Zwang, Erwartungen, Disziplin und Anpassung kennt ja wohl so gut wie jeder. Das Gefühl, dass die Müdigkeit einen im Alltag sabotiert, haben die meisten schon hautnah kennengelernt. Ist nicht unsere gesamte Gesellschaft gestresst und überfordert? Wir werden wohl um ein paar systemkritische Töne nicht herumkommen, denn schließlich reden wir von einer ernsten Sache: Ihrer Motivation, sprich: Ihrer Lebensenergie, Ihrer Begeisterung, Ihrem Sinn des Wirkens und Handelns.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, was der verborgene und sehr intelligente, aber ernste Hintergrund dieser Motivationsflaute ist – und Ihnen helfen, diese wieder zu überwinden. Dass dies geht, habe ich selbst erlebt – wie es geht, bringe ich täglich Menschen bei. Ich denke, Sie haben gute Chancen, im täglichen Leben wieder gut gelaunt und dabei hellwach zu sein! Haben Sie Lust drauf? Dann geht’s los!

Das Geheimnis
natürlicher
Muntermacher
Es war zwei Minuten nach neun am Montagmorgen, als auf dem Schreibtisch das Telefon klingelte, das sich irgendwo zwischen Stapeln von Papier und Akten verbarg. Für gewöhnlich meldete sich Hauptkommissar Thomas Grundmann1 knapp mit seinem Namen, seiner Abteilung und einem auffordernden Anheben der Stimme. Um diese Uhrzeit wollten die meisten Anrufer eine Anzeige erstatten oder für die Schadensmeldung ihrer Versicherung das Aktenzeichen eines Falls erfragen. Manchmal waren es aber auch Kollegen, die für die Bearbeitung eines Falles eine Adresse, die Tatzeit oder weitere Angaben zur Person benötigten. Seltener kam es vor, dass ein Vorgesetzter anrief, um den Fortschritt eines Vorgangs, wie es im Behördendeutsch heißt, zu erfragen – und wenn, dann meist, weil die örtliche Presse Interesse daran zeigte. Das allerdings häufte sich in der letzten Zeit mehr und mehr.
Kommissar Grundmann beachtete das Telefon kaum. Sein Blick ging ins Leere. Obwohl seine Trommelfelle den unerbittlichen Signalton vernahmen, blendete sein Geist das Läuten einfach aus. Wie lange ist es her, seit er mit seiner Frau Gabi ein entspanntes Wochenende verbracht hatte? Sie liebte es, mit ihm ausgedehnte Spaziergänge an der Talsperre zu machen. Aber sie konnte es auch genießen, einfach einmal einen ganzen Sonntag mit ihm im Bett zu bleiben und nichts zu tun. Es ist lange her. Zu lange. Die Arbeit wurde einfach immer mehr. Auch am Wochenende. Der Druck in der Behörde stieg gewaltig. Bald waren die gemeinsam verbrachten freien Tage nur noch Erinnerungen, die langsam verblassten. Wie lange ist es her, seit sie ihn verlassen hatte? Noch nicht einmal für einen anderen Mann, sagte sie. Nein, sie ging, weil sie ohnehin immer einsam gewesen war. Da könne sie besser gleich ganz alleine sein, dann vermisse sie ihn wenigstens nicht. Das waren ihre schmerzlichen Worte, die in seinem leeren Kopf widerhallten. Das Telefon schrillte weiter. Die Papierstapel, die Aktenordner und die unzähligen Notizzettel begannen vor den Augen des Kommissars zu tanzen und leicht zu verschwimmen. Der eins achtzig große Mann war im 23. Dienstjahr. Nun saß er da und spürte, wie er anfing zu zittern und zu schluchzen, bis er schließlich hemmungslos weinte wie ein Kind. Statt zum Telefon zu greifen, das noch immer schrillte, griff Grundmann in die Schublade, wo neben der Dienstpistole eine leere und eine volle Flasche Schnaps lagen. Dann wurde es ruhig.
Der Arzt sprach davon, dass Grundmann zunächst einmal zwei Wochen Pause brauche. Das sei bei einem Burn-out-Syndrom der übliche Zeitraum, um „erst mal wieder auf den Teppich zu kommen“, wie er es nannte. „Morgens zwei und abends eine“, sollte Grundmann von den Pillen nehmen, die er bekam. „Aber mit viel Wasser“, ermahnte der Mediziner. Er wolle kein Nierenversagen riskieren. Das Medikament, ein Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, greift in den Hirnstoffwechsel ein und soll beim Patienten eine Stimmungsaufhellung bewirken. Serotonin, ein Botenstoff, von dem Grundmann offenbar zu wenig hatte, wird durch den Erwartungsdruck, der auf einem lastet, verbraucht. Stresshormone hindern die Hirnanhangsdrüse zudem an der Produktion dieses kostbaren Neurotransmitters, der für das Wachbewusstsein gebraucht wird. Das Absinken von Serotonin macht sich durch Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen bemerkbar, etwa im Schulunterricht, wenn der Stoff langweilig erscheint, oder auch beim Ausüben unliebsamer Pflichten. Ein chronisches Defizit dieses und weiterer Botenstoffe führt zur Depression – „männertauglich“ auch Burn-out-Syndrom genannt.
Serotonin ist entwicklungsgeschichtlich ein Klassiker. Das in der Tier- und Pflanzenwelt seit Urzeiten weitverbreitete Hormon kann durch serotoninhaltige Nahrungsmittel wie etwa Kakao, Nüsse und Bananen aufgenommen werden. Es heißt, Kakao oder Schokolade mache angeblich glücklich. Jedoch durchdringt die nutrigene Form von Serotonin gar nicht die Blut-Hirn-Schranke und bleibt somit für unser Gehirn unerreichbar. Im Magen-Darm-Trakt reguliert das Hormon lediglich die zur Verdauung notwendige Darmbewegung. Die wohlbekannte stimmungsaufhellende Wirkung von Schokolade liegt sicher nicht am Serotonin, sondern daran, dass wir gelernt haben, Schoki wäre eine Belohnung und ein Liebesbeweis. Depressionen können allerdings und folgerichtig zu Störungen im Verdauungssystem führen, weil auch im Bauch ohne den kostbaren Stoff nichts funktioniert. Ernährungsumstellungen können zwar einen leicht positiven Einfluss haben, entscheidend für die psychische Belastbarkeit ist jedoch das Serotonin im Gehirn. Daher der pharmakologische Versuch, die Aufnahme des Hormons in den Nervenzellen zu verzögern, um dessen Wirkung länger zur Verfügung zu haben. Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer sind allerdings nicht ungefährlich. In einer Studie des Nordic Cochrane Centre in Dänemark untersuchten Forscher die Auswirkungen von Antidepressiva. Sie konnten belegen, dass in den Industrieländern im Zeitraum der letzten zehn Jahre rund fünf Millionen Menschen durch psychiatrische Medikamente zu Tode gekommen sind.
Erzeugt werden Endorphine, die sogenannten Glückshormone, zu denen Serotonin gehört, durch Spaß und Begeisterung, also durch die sinnhafte Identifikation mit dem Erlebten.
Es ist also das Müssen, das müde und letztlich krank macht; Wollen hingegen macht wach!
Für Grundmann waren die Aktenberge auf seinem Schreibtisch nur noch mit Schnaps zu ertragen, obwohl diese im Vergleich zu echten Bergen in der Landschaft, die für Menschen zu einer Lebensgefahr werden können, doch eigentlich – nüchtern betrachtet – völlig harmlos sind.
Der deutsche Profibergsteiger Thomas Huber ist – genauso wie sein jüngerer Bruder Alexander Huber – als Extremkletterer bekannt. Nicht nur das Besteigen großer Höhen ohne Hilfsmittel, sondern vor allem das Speedklettern gehört zu seinem Markenzeichen; mehrere Rekorde hat er dabei erzielt. So schnell wie möglich einen hohen, steilen Berg zu erklimmen – fällt man nicht schon allein beim Gedanken daran ins Koma? Die „Huaberbuam“ jedenfalls sind beim Klettern kaum zu bremsen. Nur kurze Zeit nach einer schweren Unfallverletzung durch einen Absturz bei Dreharbeiten im Juli 2016 bezwang Thomas Huber den Berg Latok in Pakistan, einen Siebentausender. Von Müdigkeit keine Spur. Das Bezwingen von Bergen scheint Alpinisten eher zu beflügeln. Da sollte ein bisschen Papier auf dem Schreibtisch doch eigentlich für niemanden ein ernstes Hindernis sein, oder etwa doch? Kommissar Grundmann jedenfalls war für rund drei Monate außer Gefecht, bis er schließlich zu mir in die Praxis kam. Bei ihm zog eine Katastrophe die nächste nach sich: Müdigkeit, Gereiztheit, Partnerschaftsverlust, Burnout, Alkoholismus. Ein fataler Dominoeffekt. Wir konnten diesen erfreulicherweise in kurzer Zeit stoppen, was für den Polizisten eine enorme Erleichterung bedeutete.
Doch Dominoeffekte sind bei Menschen nicht zwangsläufig unerwünscht, wie der Niederländer Robin Paul Weijers zeigt. Dieser hat sogar eine Vorliebe für Kettenreaktionen. Weijers organisierte bis 2014 den sogenannten Domino Day, eine Veranstaltung, bei der es galt, möglichst viele Rekorde mit umfallenden Dominosteinen aufzustellen. Um beispielsweise 500.000 Dominos in wenigen Sekunden zum Umfallen zu bringen, benötigt man eine Aufbauzeit von vielen Wochen – und wehe, es kippt zwischendurch ein Stein um, dann beginnt die Fleißarbeit von vorne. Monatelang Dominos aufstellen, die in Sekunden umfallen – das könnte glatt eine moderne Version des Fegefeuers für Kapitalverbrecher sein. Ist es aber nicht, denn Robin Paul Weijers liebt sein Hobby. Bis tief in die Nacht, oft bis in den frühen Morgen, dauern die Aufbauten der kunstvollen Dominobilder. Von Müssen kann da keine Rede sein. Vielmehr wird auch hier deutlich: Wollen heißt das Geheimnis eines jeden Muntermachers! Das Sichabgeschlagen-und-ausgebrannt-Fühlen hat also nichts mit der Tätigkeit und dem Energieverbrauch zu tun, sondern mit der inneren Einstellung.
Und darin liegt die Lösung! Selbst die zu erwartenden Rückenschmerzen beim Aufstellen Zigtausender Dominosteine scheinen einen Menschen nicht daran zu hindern, hellwach und fokussiert Höchstleistungen zu vollbringen. Das zeigt auch das Beispiel des Ex-Waldshuter Bandscheibenvorfall-Patienten Rolf Heck. Der damals 47-Jährige stellte im März 1990 einen Weltrekord auf, als er 31.250 Liegestützen innerhalb von 24 Stunden absolvierte. Eigentlich hatte er durch Liegestützen nur seine Bandscheibenschmerzen lindern wollen; aber in der Folge wurde sein Ehrgeiz geweckt, ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu werden. Bei dieser hohen Anzahl sportlicher Bewegungen keinen Komplettzusammenbruch zu bekommen, geht nur durch die effektivste Droge der Welt: Begeisterung! Und diese scheint keine Grenzen zu kennen: Den atemberaubenden Rekord von Rolf Heck brach der Amerikaner Charles Servizio 1993 mit 46.001 Push-ups an einem Tag! Das geht sicher nicht, wenn man das muss!
Und Sie lesen dieses Buch, obwohl Sie wahrscheinlich weder sieben Kilometer hohe Berge besteigen noch Hunderttausende von Dominosteinen aufstellen oder Tausende von Liegestützen machen, sondern bei einer ganz normalen täglichen Arbeit auf die Uhr schauen und den Feierabend herbeisehnen.
Warum also können Menschen fast mühelos die unglaublichsten Dinge vollbringen, während die ganz normale Arbeit in der Firma einen Menschen müde, erschöpft, ja sogar chronisch krank macht? Wie kommt man an diese innere Einstellung der Begeisterung, und warum fehlt sie uns oft im Alltag?
Im Coachingtermin mit Herrn Grundmann kam jedenfalls Erstaunliches heraus: Als Junge musste er für seinen kleinen Bruder Vaterersatz sein. Aufpassen, aufräumen, Aufmerksamkeit schenken – der kleine Thomas lernte, keine Pause zu machen, weil er sonst seine überforderte, alleinstehende Mutter enttäuscht hätte. Grundmann war darauf konditioniert, bis zum Umfallen seinen Mann zu stehen. Dieses Muster hielt sich bis ins Erwachsenenalter und kostete ihn letztlich seine Gesundheit. Und damit war mein Klient nicht allein.
Was programmiert die innere Uhr?
Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland zehn bis 25 Prozent aller Erwerbstätigen bereits am Burn-out-Syndrom gelitten haben, jeder Neunte gilt als behandlungsbedürftig. Es beginnt meist harmlos, unauffällig und schleichend. Die Erleichterung darüber, dass endlich Feierabend ist, und das Gefühl, morgens zunehmend schlechter wach zu werden, sind deutliche Vorboten. Doch es steigert sich: Gereiztheit wechselt sich mit Niedergeschlagenheit ab. Antriebslos und überfordert bringt man den Tag hinter sich. Nicht nur der Arbeitstag, nein, der ganze Tag, das ganze Leben erscheint plötzlich wie ein hoher Berg, den man nicht mehr bewältigen kann. Alkohol und Tabletten sind Strohhalme, an die man sich klammern möchte, im Wissen darum, dass einen nichts mehr vor dem Untergang retten kann.
Das Syndrom ist vielschichtig und facettenreich. Hektik, Wutanfälle, langes Vor-sich-hin-Starren und Sekundenschlaf gehören dazu. Wie im Falle von Thomas Grundmann macht das Läuten des Telefons Angst, es erzeugt sogar körperliche Schmerzen. Jede kleinste neue Anforderung ist wie der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Glück hat, wer noch in der Lage ist, weinen zu können – das entlastet wenigstens etwas. Und immer wieder überfällt einen die unberechenbare Müdigkeit: morgens, mittags, nachmittags. Interessanterweise berichten viele Menschen mit Erschöpfungszuständen, dass sie sich am Abend, wenn üblicherweise langsam die Nachtruhe eintreten sollte, noch am leistungsfähigsten fühlen, dass sie teilweise bis tief in die Nacht hinein wach liegen und paradoxerweise nicht schlafen können.
Was aber macht den Tag zur Qual und die Nacht zur Kür?
Die Ursache liegt im Verborgenen: Meistens ist es eine tief sitzende Angst vor Ablehnung, erzeugt im frühen Kindesalter, die mit eiserner Disziplin überspielt wurde. Es ist das Gefühl, nicht zu genügen, sich durch Leistung eine Existenzberechtigung erarbeiten zu müssen. Fehlendes Selbstwertgefühl ist ein wichtiger Grund, der aus einem Menschen eine Pflichterfüllungsmaschine macht, die viel zu lang schon hochtourig läuft und einen seelischen Kolbenfresser entwickelt. Bloß nicht nachlassen, nur nicht versagen, auf keinen Fall Schwäche zeigen – das ist es, was den Motor zum Qualmen bringt. Herzprobleme und Suizidgedanken sind naheliegend. Botenstoffe wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, die dringend für Antriebsstärke und Leistungsfähigkeit gebraucht werden, sind dann nicht mehr ausreichend im Gehirn des Betroffenen vorhanden.
Selbstverständlich ist ein Gefühl von Müdigkeit noch lange nicht pathologisch. Schließlich werden wir ja alle täglich müde und müssen schlafen. Chronischer Schlafentzug macht krank. Wir brauchen unseren Schlaf. Aber wie viel Schlaf brauchen wir? Und vor allem, wann und aus welchem Grund? Rund 33 Prozent unseres Lebens verschlafen wir, Katzen sogar doppelt so viel. Würden wir auf Dauer täglich nur drei Stunden zur Ruhe kommen, bekämen wir ohne spezielle Anpassung daran ein ausgewachsenes gesundheitliches Problem. Es gibt zwar Menschen, die mit wenigen Stunden Schlaf pro Tag auskommen, doch ist dies eher die Ausnahme. So soll der französische General und Kaiser Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) nur vier Stunden am Tag geschlafen haben, während dem deutschen Physiker Albert Einstein (1879 – 1955) 12 bis 14 Stunden Schlaf nachgesagt werden.
Erdhörnchen schlafen im Jahr ganze neun Monate. Das ist sicher beneidenswert in den Augen aller, die mit Schlafstörungen zu kämpfen haben. Aber wenn wir verdächtig oft müde sind, wenn wir zu Tageszeiten mit dem Schlaf kämpfen, an denen wir eigentlich fit sein sollten, dann stimmt etwas nicht.
Interessanterweise sind Schlaf und Müdigkeit in unseren Breiten gesellschaftlich verpönt. Wir beschimpfen unsere Mitmenschen als Schlafmütze, Penner und Faultier. Wir ermahnen: „Schlaf nicht ein!“, „Träum nicht herum“ – und verweisen mit Sprichwörtern wie „Morgenstund’ hat Gold im Mund!“ oder „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ darauf, dass morgens von uns Leistungsbereitschaft erwartet wird. Mit Ausdrücken wie Nachteule, Nachtschattengewächs oder Nachtschwärmer wird abwertend ausgedrückt, dass die Nacht zum Schlafen genutzt werden sollte – und nicht etwa zum Vergnügen! Dem Phänomen, dass es auch nachtaktive Menschen gibt, deren Leistungskurve am Nachmittag erst ansteigt und morgens ganz unten ist, wird damit nicht Rechnung getragen. Die medizinische Forschung jedenfalls konnte noch nicht alle damit verbundenen Rätsel lösen. Der Nobelpreis für Medizin ging im Jahr 2017 an die drei amerikanischen Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Sie wiesen ein Protein im Körper nach, welches als sogenannte Innere Uhr unabhängig vom Tageslicht und einer Zeitumstellung das Schlafhormon Melatonin reguliert. Dieses Taktgeber-Molekül, welches die Preisträger entdeckten, soll angeblich dafür sorgen, dass sich der Organismus an die Drehung der Erde ankoppelt und uns morgens munter und abends müde macht. Ob wir wirklich alle so programmiert sind, darf man allerdings infrage stellen.
Der in Rumänien geborene Wissenschaftler Franz Halberg (1919 – 2013) entdeckte und benannte den für das Leben wichtigen zirkadianen Rhythmus und erkannte Zyklen vieler anderer Längen, z. B. wöchentliche, monatliche, jährliche sowie Sonnen-, Mond- und andere Zyklen. Professor Halberg verdanken wir die Erkenntnis, dass die Synchronisierung dieser Zyklen zwar genetisch angelegt, aber eben nicht starr festgelegt ist. Sie können durch unsere Lebensweise beeinflusst werden. Man ist nicht durch Vererbung entweder eine Lerche (Morgenmensch) oder eine Eule (Nachtmensch), sondern kann dies durchaus verändern.
Diese Erfahrung musste auch der siebenjährige Marco machen. Wie viele Kinder hörte auch er Abend für Abend den Satz: „Ab ins Bett mit dir!“ So gut wie am Ende jedes Tages hatte seine Mutter Martina große Mühe, ihn zu bändigen. Der Junge erfand stets neue Ausreden, warum er einfach nicht schlafen gehen wollte. Pipimachen, Hunger, Durst oder noch eine Geschichte hören gehörten zu seinem Standardrepertoire, mit dem er die Schlafenszeit hinauszuzögern versuchte. Hingegen war der Zweitklässler am Morgen wie in Narkose, wenn es darum ging, endlich aufzustehen und zur Schule zu gehen. Es reichte nicht, dass der Wecker Sturm klingelte, meistens musste Martina ihren Sprössling eindringlich auffordern, endlich aus den Federn zu kommen. Dementsprechend energisch bestand sie auch darauf, dass Marco sich an die Zu-Bett-geh-Zeit hielt. Doch der Protest war stets vorprogrammiert.
Vor Kurzem bekamen die Eltern vom Kinderarzt die Diagnose ADHS für ihren Sohn. Gewundert hat sie das nicht, war er doch schon von klein auf eher quirlig und überaus aufgeweckt. Nur in der Schule ging es nach kurzem Glanzstart steil bergab mit seinen Leistungen. Robert, ein Arzt und Freund der Familie, wusste Rat. Ein Medikament mit dem Wirkstoff Methylphenidat, bekannt als Ritalin, sollte Marcos Hirnstoffwechsel regulieren. Wie lange der Junge das Medikament braucht, um geheilt zu sein, konnte der Mediziner allerdings nicht mit Bestimmtheit sagen. Auch Martinas bange Frage, ob das Betäubungsmittel Ritalin nicht die Parkinson‘sche Krankheit im Alter begünstige, wie der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther nachgewiesen hat, konnte der Arzt nicht beantworten. Ebenso wenig wie die Frage, warum Marco einerseits so aufgedreht war, andererseits in der Schule manchmal fast einschlief.
Dabei ist die Antwort relativ leicht zu finden, wenn man es fertigbringt, einen Faktor mit in die Gleichung einzubringen, der in der Medizin, in der Psychiatrie, in der Pädagogik, ja sogar in der Psychologie entweder abgelehnt oder zumindest nicht ernst genommen wird, weil er wissenschaftlich nicht fassbar scheint: Es ist der Faktor der subjektiven, emotionalen Bewertung. So ist nämlich entscheidend, wie ein Mensch das, was er erlebt, interpretiert. Dieser Faktor schließt die viel bemühte Objektivität im menschlichen Verhalten kategorisch aus. Menschen sind keine Objekte. Sie sind keine biochemische Maschine. Menschen sind auf einer formalen Ebene sicherlich gleich, haben aber eine individuelle Persönlichkeit, so unterschiedlich wie ein Fingerabdruck. Menschen haben zudem ein Unterbewusstsein. Dieses läuft wie ein Hintergrundprogramm, das darüber entscheidet, aus welchem Grund man etwas tut oder unterlässt. Diese Entscheidung hat einen derart immensen Einfluss auf unseren gesamten Hirnstoffwechsel, dass es meiner Ansicht nach an einen grob fahrlässigen Kunstfehler grenzt, den subjektiven Faktor unberücksichtigt zu lassen. Es sind nämlich nicht die rationalen, bewussten Entscheidungen, die unser Verhalten steuern, sondern ganz im Gegenteil: die Emotionen. Sie arbeiten im Unterbewussten und steuern den Hormon- und Neurotransmitterhaushalt sowie den Stoffwechsel. Emotionen unterliegen allesamt einer persönlichen, subjektiven Bewertung und lassen Botenstoffe ausschütten – oder auch wieder einstellen. Es macht somit einen großen Unterschied, ob ich glaube, etwas tun zu müssen, oder ob ich etwas tun will!
Der Vorsitzende des Bremer Hausärzteverbandes, Dr. med. Hans-Michael Mühlenfeld, glaubt, mögliche Ursachen für Müdigkeit könnten ein extrem langsamer Herzschlag, Blutarmut, Diabetes, Schilddrüsenprobleme oder das Schlaf-Apnoe-Syndrom sein. Zudem könnten Medikamente ebenso müde machen wie übermäßiger Alkoholkonsum. Dr. Mühlenfeld gibt aber unumwunden zu bedenken, es ließe sich oftmals für Müdigkeit keine körperliche Ursache finden; eher seien wohl psychische Belastungen, wie ständiger Stress in der Arbeit oder Angststörungen, Gründe für Erschöpfung.
Marco jedenfalls hatte rasch die Erfahrung gemacht, dass die Schule für ihn kein Ort des begeisternden Interesses ist, sondern dass ihm diese aufgrund des mit ihr verbundenen Erwartungsdrucks eine Menge Disziplin abverlangt. Abends jedoch wurde es für ihn immer interessant. Die Eltern waren zusammen im Wohnzimmer, und er wollte einfach mit dabei sein.
Ein weiterer Faktor ist, dass die tägliche Leistungskurve von Einflüssen während der Embryonalentwicklung beeinflusst wird. Neun Monate lang spürt das Baby im Mutterleib den Tages- und Nachtrhythmus der Mutter und reagiert entsprechend darauf. Nach der natürlichen (das heißt naturbelassenen, nicht durch Zivilisationsstress beeinflussten) Schwangerschaftsdauer von durchschnittlich 273 Tagen2 erfolgt die Geburt innerhalb von weniger als einer Stunde nach dem Blasensprung, der vom Baby ausgelöst wird. Und zwar dann, wenn es sich wach und kräftig genug fühlt, mit einem deutlichen Stresshormonsignal die Wehen als Befreiungsschlag einzuleiten. Den hierdurch entstehenden Tagesrhythmus kann man bis ins hohe Alter beibehalten. Wenn die Geburt allerdings verzögert wird und daher länger dauert, muss man die Geburtsdauer beim Errechnen der Leistungskurve mit berücksichtigen.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.