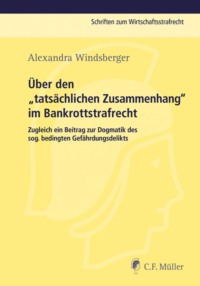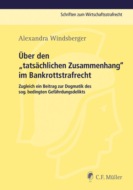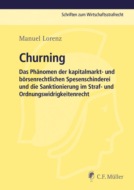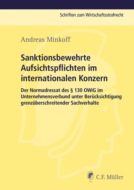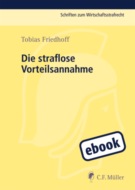Buch lesen: "Über den "tatsächlichen Zusammenhang" im Bankrottstrafrecht"
Über den
„tatsächlichen Zusammenhang“
im Bankrottstrafrecht
Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des sog. bedingten Gefährdungsdelikts
von
Alexandra Windsberger

Über den „tatsächlichen Zusammenhang“ im Bankrottstrafrecht › Herausgeber
Schriften zum Wirtschaftsstrafrecht
Herausgegeben von
Prof. Dr. Mark Deiters, Münster
Prof. Dr. Thomas Rotsch, Gießen
Prof. Dr. Mark Zöller, Trier
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-4462-1
E-Mail: kundenservice@cfmueller.de
Telefon: +49 89 2183 7923
Telefax: +49 89 2183 7620
© 2017 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Zugl.: Saarbrücken Univ., Diss., 2016
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM) Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Die Arbeit wurde im Sommersemester 2016 von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes als Dissertationsschrift angenommen. Sie wurde für die Drucklegung aktualisiert und berücksichtigt den Stand von Rechtsprechung und Literatur bis einschließlich Dezember 2016.
Herzlich danken möchte ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Marco Mansdörfer, der die Anregung zu der vorliegenden Untersuchung gab und mir so eine in die Grundlagen der Strafrechtsdogmatik hineinreichende und deshalb vielseitige Forschungsarbeit ermöglichte. Er hat in seiner Betreuung stets das richtige Maß zwischen geistiger Anregung, akademischer Freiheit und wohlwollender doktorväterlicher Strenge walten lassen, wodurch es mir möglich wurde, die an mich gestellten Anforderungen zu bewältigen, ohne mich in zeitlicher oder inhaltlicher Hinsicht zu verlieren.
Weit mehr als eine angenehme Pflicht ist es mir, mich bei Herrn Prof. Dr. Heinz Koriath für sein großzügiges Engagement zu bedanken. Er hat mich und diese Arbeit auf vielfältige Weise gefördert und durch zahlreiche Anregungen und geduldige Gespräche das Gelingen der Arbeit wesentlich beeinflusst.
Mein Dank gilt ferner den Herausgebern und Professoren Dres. Mark Deiters, Thomas Rotsch und Mark Zöller für die Aufnahme in diese Reihe.
Den Herren Prof. Dr. Guido Britz, Dr. Jörg Habetha und Patrick van Bakel danke ich herzlich für die regen Diskussionen und den fachlichen Austausch, auch wenn ich nicht jede ihrer Kritiken berücksichtigt habe. Profitiert habe ich von diesen Streitgesprächen dessen ungeachtet immer.
Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. Charlotte Schmitt Leonardy für den aufmunternden Zuspruch und ihren ökonomischen Sachverstand, der mir über schwierige Phasen und Fragen hinweghalf.
All denen, die das Entstehen dieser Arbeit mit Interesse begleitet haben, möchte ich an dieser Stelle wenigstens in toto sehr herzlich danken. Meinem lieben Freund Stefan Engel danke ich für den technischen Support, den er aus den USA in den Nachtstunden leistete. Ohne die Unterstützung meines geliebten Gatten, die im Einzelnen hier gar nicht hoch genug gewichtet werden kann, wäre diese Arbeit sicher sehr viel schlechter ausgefallen.
Die Arbeit wurde mit dem Dr.-Eduard-Martin-Preis 2017 der Universitätsgesellschaft des Saarlandes ausgezeichnet.
Saarbrücken im Januar 2017 Alexandra Windsberger
Vorwort › Widmung
Meinen Eltern
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Teil 1 Die dogmengeschichtliche Entwicklung
A.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Geltungsbereich der Konkursordnung
I.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext des einfachen Bankrotts
1.Die „Bankrotthandlung“
2.Der Relativsatz „Schuldner, welche (...)“
3.Das Verhältnis zwischen Bankrotthandlung und Konkurs?
4.Die Rechtsnatur des Bankrotts in der Interpretation durch das Reichsgericht
II.Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch die konkursstrafrechtliche Rechtsprechung
1.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Rahmen des § 210 Nr. 2 KO
a)Die Entscheidung des 1. Senats vom 21.11.1881
b)Die Entscheidung des 2. Senats vom 27.11.1896
c)Zusammenfassung
2.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Rahmen des § 209 Nr. 4 KO und § 210 Nr. 2, Var. 2 KO
a)Die Entscheidung des 3. Senats vom 8.10.1883
b)Die Entscheidung des 1. Senats vom 8.12.1884
c)Die Entscheidung des 4. Senats vom 1.4.1892
d)Zusammenfassung
3.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Rahmen des § 210 Nr. 1 KO
a)Die Entscheidung des 4. Senats des BGH vom 8.6.1920
b)Die Entscheidung des BGH vom 20.3.1951
c)Die Entscheidung des 1. Senats des BGH vom 8.5.1951
d)Zusammenfassung
4.Erste Zwischenbetrachtung: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als unrechtsbegründender Faktor
a)Der „zeitliche“ Zusammenhang im Rahmen informationsbezogener Bankrotthandlungen
b)Der „sachliche“ Zusammenhang im Rahmen bestandsbezogener Bankrotthandlungen
c)Der „tatsächliche“ Zusammenhang als restringierendes teleologisches Korrektiv?
III.Der „tatsächliche Zusammenhang“ in der Interpretation durch das konkursstrafrechtliche Schrifttum: Zusammenhang zwischen Handlung und Erfolg?
1.Die Frage nach dem geschützten Rechtsgut
a)Zum Stand der Rechtsgüterlehre des 19. Jahrhunderts
b)Das geschützte Rechtsgut der Konkursdelikte
2.Der Relativsatz als Umschreibung der „Rechtsgutsbeeinträchtigung“
3.Zusammenhang zwischen Bankrotthandlung und „Rechtsgutsbeeinträchtigung“?
a)Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „schuldindifferenter äußerer Zusammenhang“ zwischen Handlung und Erfolg?
b)Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „präsumtiver Kausalzusammenhang“?
4.Zweite Zwischenbetrachtung: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als verkappter Kausalzusammenhang?
IV.Stellungnahme: Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Hilfsmittel einer erfolgsorientierten Auslegung
1.Dogmatische Inkonsistenzen
a)Strafe ohne Schuld
b)Auslegung contra legem
2.Anschlussprobleme
a)Beginn der Strafverfolgungsverjährung?
b)Inkonsistenzen im Bereich der Versuchsstrafbarkeit
c)Inkonsistenzen im Bereich der Teilnahmestrafbarkeit
3.Zusammenfassung
B.Die Verlagerung des Unrechtszentrums auf die Bankrotthandlung: eine Perspektivenverschiebung
I.Der Bankrott als abstraktes Gefährdungsdelikt
1.Unrecht durch abstrakte Gefährdung?
2.Zahlungseinstellung/Konkurseröffnung als objektive Bedingung der Strafbarkeit?
3.Fortbestand des „tatsächlichen Zusammenhangs“?
II.Würdigung
1.Unangemessene Fixierung von Kriminalität
2.Der einfache Bankrott als Anwendungsfall einer mittelalterlichen Erfolgshaftung?
3.Der „tatsächliche Zusammenhang“ als ungeeignetes Mittel zur Beschränkung einer Erfolgshaftung
III.Der Beginn einer Reform des Konkursstrafrechts
1.Die Einwände der großen Strafrechtskommission gegen das geltende Konkursstrafrecht
2.Dogmatisch-konstruktive Ersetzung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ durch eine Umgestaltung der Bankrottdelikte
a)Die Einführung eines konkreten Gefährdungsdelikts
b)Sonderproblem: Die Buchdelikte
3.Stellungnahme: Unzulänglichkeit der frühen Reformvorschläge
a)Die konkrete Gefahr als Surrogat für den Verletzungserfolg?
b)Einwände gegen die Beibehaltung der alten Rechtslage im Rahmen der Buchdelikte
4.Zusammenfassung
IV.Die Versöhnung mit dem Schuldprinzip: Das 1. WiKG
1.§ 283 StGB: Der Bankrott im Kontext der „wirtschaftlichen Krise“
a)Die wirtschaftliche Krise als neues unrechtsbegründendes Merkmal
b)Das geschützte Rechtsgut
c)Auffüllen des tatbestandlichen Unrechtsgehalts durch weitere normative Tatbestandsmerkmale
d)Neuverortung des Relativsatzes in § 283 Abs. 6 StGB
2.§ 283b StGB: Die Verletzung der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht außerhalb der Krise
a)Abstraktes Gefährdungsdelikt außerhalb der Krise
b)Inhalt und Funktion des § 283b Abs. 3 StGB
3.Konsequenz für den „tatsächlichen Zusammenhang“ nach der Gesetzesreform
C.Rückschritt durch Rechtsanwendung?
I.Nichtbeachtung der Bezugsgegenstandsänderung
II.Die Entscheidung des BVerfG zu § 240 KO
III.Die Übertragung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ durch die Rechtsprechung in der Bundesrepublik
1.Entscheidungssammlung zum „tatsächlichen Zusammenhang“ im Rahmen des § 283b StGB
a)Die Entscheidung des BGH vom 20.12.1978
b)Die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 27.9.1979
c)Die Entscheidung des BayObLG vom 8.8.2002
d)Die Entscheidung des BayObLG vom 3.4.2003
e)Der Beschluss des 1. Senats des BGH vom 19.8.2009
f)Die Entscheidung des 1. Senats des BGH vom 13.2.2014
2.Die Anwendung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ auf § 283 StGB
a)Die Entscheidung des 3. Senats des BGH vom 23.8.1978
b)Die Entscheidung des 1. Senats des BGH vom 10.2.1981
c)Die Entscheidung des 3. Senats des BGH vom 30.8.2007
3.Ergebnis: Rückschritt durch Rechtsanwendung
IV.Der Lösungsansatz des bankrottstrafrechtlichen Schrifttums
1.Die herrschende Auffassung: Notwendigkeit eines Zusammenhangs zwischen Handlung und Bedingung
a)Der „tatsächliche Zusammenhang“ als sog. „Gefahrrealisierungszusammenhang“
b)Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „schuldindifferenter Kausalzusammenhang“
c)Der „tatsächliche Zusammenhang“ in Gestalt des „Gegenbeweises der Ungefährlichkeit“
d)Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „außerordentliches Zurechnungskriterium“
e)Der „tatsächliche Zusammenhang“ als „ungeschriebene Einschränkung“ des § 283 Abs. 6 StGB
2.Notwendigkeit eines Zusammenhangs zwischen Krise und Bedingung: Der krisenspezifische „Unmittelbarkeitszusammenhang“
3.Die Gegenauffassung: Kein Bedürfnis für ein übergesetzliches Korrektiv in Form eines Zusammenhangs
V.Stellungnahme: Notwendigkeit einer übergesetzlichen Korrektur?
Teil 2 Materiellrechtliche Erforderlichkeit eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ als übergesetzliches Korrektiv?
A.Korrekturbedürfnis im Rahmen der §§ 283 ff. StGB?
I.Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Symptom eines korrekturbedürftigen Delikts
1.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext sog. „Risikogeschäfte“ mit „positivem Ausgang“
2.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext der sog. „Krisenüberwindung“
3.Der „tatsächliche Zusammenhang“ zur Vermeidung eines „ewigen Delikts“
II.Das „bedingte Gefährdungsdelikt“ als Ursache?
B.Das „bedingte Gefährdungsdelikt“ als Bezugsgegenstand
I.Zur Rechtsnatur des bedingten Gefährdungsdelikts
II.Sonstige „bedingte“ Delikte des besonderen Teils
1.Der Tatbestand des § 231 StGB
2.Der Tatbestand des § 323a StGB
3.Der Tatbestand des § 186 StGB
4.Der Tatbestand des § 113 StGB
5.Der Tatbestand des § 104a StGB
6.Der Tatbestand des § 130 OWiG
7.Zwischenergebnis: Allgemeines Korrekturbedürfnis des „bedingten Gefährdungsdelikts“
C.Allgemeines Anforderungsprofil an das „bedingte Gefährdungsdelikt“
I.Die Minimalanforderungen an das Schuldprinzip
1.Das Kongruenzgebot
2.Interdependenz von Kongruenzgebot und Abzugsthese
3.Das gleichzeitige Erfordernis eines „hinreichenden“ Tatbezugs
4.Die Paradoxie der objektiven Bedingung der Strafbarkeit
II.Schlussfolgerung: Zwei Interpretationsmöglichkeiten des bedingten Gefährdungsdelikts
1.Das bedingte Gefährdungsdelikt im Kontext der Verbindungsthese
2.Das bedingte Gefährdungsdelikt im Kontext der Trennungsthese
3.Konsequenz für das Bankrottstrafrecht
Teil 3 Anwendung auf das Bankrottstrafrecht
A.Interpretationsvorschlag des § 283 Abs. 1 StGB nach der Verbindungsthese
I.Ausgangspunkt: § 283 Abs. 6 StGB als „Erfolgskomponente“
II.Konsequenz: Erfordernis einer Deckungsbeziehung
1.Verknüpfung über einen Kausalzusammenhang?
a)Maßstab der Verursachung eines Erfolges
b)Formulierung eines Kausalgesetzes im Sinne des § 283 Abs. 1 StGB
2.Verknüpfung über einen Schuldzusammenhang?
3.Verknüpfung über einen tatsächlichen Zusammenhang?
III.Ablehnung der Verbindungsthese
B.Interpretationsvorschlag des § 283 Abs. 1 StGB nach der Trennungsthese
I.Dogmatische Vorüberlegungen zum Strafgrund abstrakter Gefährdungsdelikte
1.Abstraktionsüberschuss abstrakter Gefährdungsdelikte?
2.Strafgrund der abstrakt gefährlichen Handlung?
a)Legitimation abstrakter Gefährdungsdelikte nach der Präsumtionstheorie
b)Legitimation abstrakter Gefährdungsdelikte auf Grund der „generellen Gefährlichkeit“ bestimmter Tätigkeiten
3.Strafgrund des „ungefährlichen Einzelfalls“?
a)Zulassung des Gegenbeweises der Ungefährlichkeit
b)Teleologische Reduktion bei erwiesener Ungefährlichkeit der Handlung?
II.Stellungnahme: Das hier vertretene Konzept zur Begründung abstrakter Gefährdungsdelikte
1.Das Schutzkonzept
a)Das abstrakte Gefährdungsverbot im Wirtschaftsstrafrecht als gesetzlich fixierte Maximin-Regel
b)Materielle Anforderungen an abstrakte Gefährdungsverbote
c)Gefahrprognose allein durch den Gesetzgeber
d)Ausschluss der Rückschau
2.Reduktionsbedürfnis des ungefährlichen Einzelfalls
a)Unzulässigkeit teleologischer Reduktionen
b)Einschränkungsmöglichkeit ausschließlich über gesetzlich normierte „persönliche Strafausschließungsgründe“
3.Das „bedingte Gefährdungsdelikt“ als Sonderfall
III.Zwischenergebnis und Konsequenz für den weiteren Gang der Arbeit
C.Anwendung der Trennungsthese auf § 283 Abs. 1 StGB
I.Der situative Kontext der Regulierung: Die Krise
1.Konkretisierung der Krise als außergewöhnliche Entscheidungssituation
2.Konsequenz für die Einordnung des Bankrotts als abstraktes Gefährdungsdelikt?
II.Strafgrund der bestandsbezogenen Gefährdungsalternativen
1.Die herrschenden Auffassungen zum geschützten Rechtsgut der bestandsbezogenen Tatalternativen
a)Schutz der materiellen „Befriedigungsinteressen“ der Gläubiger?
b)Schutz vor „enttäuschtem Vertrauen“?
c)Schutz sonstiger „kollektiver“ Rechtsgüter?
2.Stellungnahme: die bestandsbezogenen Tatalternativen als abstrakte Vermögensgefährdungsdelikte
a)Unzureichende präventive Gläubigerschutzvorschriften des Zivilrechts
b)Der Bankrott als eine Art „Gläubigeruntreue“?
aa)Besondere Verhaltenspflichten des Schuldners in der Krise
bb)Das Schuldverhältnis in der Krise als besonderes Treueverhältnis
cc)Die Gefährdungsverbote des § 283 Abs. 1 StGB als Verfügungsverbote
c)Die einzelnen bestandsbezogenen Tatalternativen als untreueähnliche Pflichtverletzung
aa)§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB
bb)§ 283 Abs. 1 Nr. 2 StGB
cc)§ 283 Abs. 1 Nr. 3 StGB
dd)§ 283 Abs. 1 Nr. 4 StGB
ee)§ 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB
ff)Zusammenfassung
d)Unrechtsausschluss durch Einwilligung aller Gläubiger?
3.Zusammenfassung: Hinreichender Unrechtsgehalt der bestandsbezogenen Tatalternativen
III.Strafgrund der informationsbezogenen Tatalternativen
1.Die herrschenden Auffassungen zum Strafgrund der informationsbezogenen Tatalternativen
a)Schutz vor unzureichender Selbstinformation des Schuldners
b)Schutz vor unzureichender Fremdinformation der Verfahrensbeteiligten im Insolvenzverfahren
2.Stellungnahme
a)Einwände gegen die herrschende Meinung
b)Einwände gegen die behauptete Strukturähnlichkeit zu den Urkundsdelikten
c)Die Buchdelikte als Blankettstraftatbestände
d)Die Buchdelikte als Vermögensgefährdungsdelikte?
aa)Buchführungsverstöße gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB i.V.m. § 239 HGB
bb)Vernichtung von Unterlagen gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 6 StGB i.V.m. § 257 Abs. 1 und Abs. 4 HGB
cc)Bilanzpflichtverstöße gemäß § 283 Abs. 1 Nr. 7 StGB i.V.m. §§ 242, 243 HGB
3.Zusammenfassung: Hinreichender Unrechtsgehalt der informationsbezogenen Tatalternativen in der Krise
IV.Zwischenergebnis nach der Abzugsthese
V.Zur Bedeutung der objektiven Strafbarkeitsbedingung in § 283 Abs. 6 StGB
1.Die objektive Strafbarkeitsbedingung als Zweckmäßigkeitserwägung
2.§ 283 Abs. 6 StGB als eine Art „Vorbehaltsklausel“
3.Konsequenz: Verzicht auf einen „tatsächlichen Zusammenhang“
a)Ungerechtigkeit einer vom „tatsächlichen Zusammenhang“ gelösten, zufälligen Strafverschonung?
b)Strafbefreiende Berücksichtigung der Nachholung der Buchführungs-/Bilanzierungspflicht vor Eintritt der Bedingung?
c)Erforderlichkeit einer zeitlichen Beziehung zwischen Handlung und Bedingung?
d)Berücksichtigung der Krisenüberwindung vor Bedingungseintritt?
aa)Berücksichtigung einer Sanierung im Schutzschirmverfahren
bb)Berücksichtigung einer freien Sanierung vor Bedingungseintritt
VI.Gesamtergebnis für § 283 Abs. 1 StGB
D.Anwendung der Trennungsthese auf § 283b StGB
I.Anwendung der Abzugsthese: Kein hinreichender Unrechtsgehalt in § 283b Abs. 1 StGB
II.Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung?
III.Der „tatsächliche Zusammenhang“ als Hilfsmittel?
IV.Gesamtergebnis für § 283b StGB: Unangemessene Sanktionswahl des Gesetzgebers
Teil 4 Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
A.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext des § 283 StGB
B.Der „tatsächliche Zusammenhang“ im Kontext des § 283b StGB
Literatur
Stichwortverzeichnis
Einleitung
1
Der 1. Strafsenat des BGH hat zuletzt im Rahmen des § 283b StGB festgestellt, dass eine Strafbarkeit wegen Buchführungspflichtverletzung neben den tatbestandlichen Voraussetzungen von einem weiteren ungeschriebenen Merkmal abhänge.[1] Damit bestätigte der 1. Senat die seit nunmehr 130 Jahren vorherrschende obergerichtliche Rechtsprechung[2] und die Ansicht des bankrottstrafrechtlichen Schrifttums[3], wonach zwischen der tatbestandlichen Bankrotthandlung und der objektiven Strafbarkeitsbedingung des „wirtschaftlichen Zusammenbruchs“ in § 283 Abs. 6 StGB ein „irgendwie gearteter“[4], „noch näher zu bestimmender“, „tatsächlicher Zusammenhang“[5] bestehen müsse.
2
Das ungeschriebene Erfordernis eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ stellt im Bankrottstrafrechts inzwischen eine Selbstverständlichkeit dar, ähnlich der Vermögensverfügung beim Betrug. Dieser allgemein für erforderlich gehaltene Zusammenhang ist hierbei nicht nur ein Spezifikum des Bankrottstrafrechts, sondern insgesamt ein Unikum im gesamten Strafrecht, dessen nähere Konturen auch nach 130 Jahren Rechtspraxis nicht geklärt zu sein scheinen. Bei seinem Versuch einer Konkretisierung betonte das Bayerische Oberste Landgericht den Verzicht auf einen Kausalzusammenhang einerseits, obgleich es den Zusammenhang in die Nähe einer Art Zurechnungszusammenhang rückte: „In der Rechtsprechung ist aber das grundsätzliche Erfordernis eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ zwischen Buchdelikt und objektiver Strafbarkeitsbedingung anerkannt. Danach müssen im Zeitpunkt des wirtschaftlichen Zusammenbruchs wenigstens noch irgendwelche Auswirkungen vorhanden sein, die sich als gefahrerhöhende Folge der Verfehlung darstellen.“[6]
3
Soweit die Bestrafung des Schuldners davon abhängen soll, ob sich die in der Handlung zum Ausdruck kommende Gefahr „tatsächlich realisiert“ oder zumindest „erhöht“ hat,[7] liegt eine Deutung als Kausal- und Zurechnungszusammenhang durchaus nahe; dies soll er nach herrschender Meinung jedoch gerade nicht sein.[8] Die Bezeichnung eines normativen Zusammenhangs ist jedoch – ebenso wie seine Fixierung als „sachlich“, „äußerlich“, „irgendwie geartet“ – überaus unbestimmt und kann nur schwer in die allgemeine Strafrechtslehre eingeordnet werden. Der Zusammenhang wird daher mancherorts als „Blind-Formel“[9] bezeichnet, die in bestimmten Fallkonstellationen nur noch „fiktive Züge“ trage. Insofern erstaunt es nicht, dass resignierende Deutungen, an den Zusammenhang seien „keine hohen Anforderungen zu stellen“[10], da sein Vorliegen „in aller Regel vermutet“[11] werde, die Auslegung bestimmen. In bestimmten Konstellationen obliege daher dem Täter der Gegenbeweis eines fehlenden Zusammenhangs. Die Bildung einer hinreichenden Definition, die auf allseitige Zustimmung treffen kann, scheint folglich in weiter Ferne.[12]
4
Da der „tatsächliche Zusammenhang“ offensichtlich ein den Normanwendungsbereich korrigierendes, ungeschriebenes Merkmal darstellt, dass keinen Anknüpfungspunkt im Wortlaut der Norm findet, stellt sich noch vor der Frage seiner inhaltlichen Konkretisierung die Frage nach seiner materiell-rechtlichen (Nicht-)Erforderlichkeit. An der Frage nach der Existenzberechtigung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ brechen sich sodann weitere unterschiedlichste Fragen. Zunächst wird daher die dogmengeschichtliche Herkunft des Merkmals näher in den Blick zu nehmen sein, wobei insbesondere die reichsgerichtliche Rechtsprechung zu den Strafbestimmungen der Konkursordnung thematisiert werden muss, da das Erfordernis eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ ursprünglich auf eine Entscheidung des Reichsgerichts zum einfachen Bankrott (§ 210 KO) aus dem Jahre 1881 zurückgeht. Diese Rechtsprechung des RG zum „tatsächlichen Zusammenhang“ übertrug der BGH sodann, obwohl die Bankrotttatbestände ihrerseits im Zuge des 1. Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität im Jahre 1976 einer umfassenden Reform unterzogen wurden. Daher wird ein besonderes Augenmerk auf die Frage gelegt, inwieweit der Transfer reichsgerichtlicher Anschauungen bei zwischenzeitlich verändertem Bezugsobjekt überhaupt noch überzeugen kann, oder ob sich der „tatsächliche Zusammenhang“ zwischenzeitlich nicht sogar entkontextualisiert hat.
5
Im Anschluss ist die gegenwärtige Diskussion um den „tatsächlichen Zusammenhang“ im Kontext der Dogmatik der abstrakten Gefährdungsdelikte[13] näher in den Blick zu nehmen. Gerade die Frage nach einer deliktsspezifischen Verknüpfung von Gefährdungsdelikt und schuldindifferenter objektiver Strafbarkeitsbedingung bedarf hierbei einer besonderen Betrachtung. Denn das Erfordernis eines „tatsächlichen Zusammenhangs“ müsste sodann in Übereinstimmung mit den Anforderungen an das Schuldprinzip konkretisiert, in seiner Reichweite anhand objektiver Parameter bestimmt und einem praktikablen Anwendungsbereich zugewiesen werden. Soweit die Einpassung des „tatsächlichen Zusammenhangs“ in das bestehende, kriminalstrafrechtliche System nicht kohärent begründbar ist, werden im letzten Teil das Bedürfnis nach dem limitierenden Merkmal des „tatsächlichen Zusammenhangs“ grundsätzlich in Frage gestellt und eine alternative Herangehensweise vorgeschlagen.