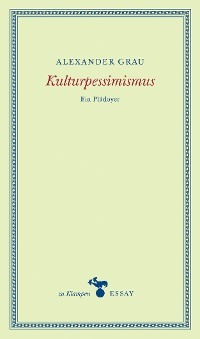Buch lesen: "Kulturpessimismus"
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Alexander Grau,
geboren 1968, lebt und arbeitet in München. Er studierte an der Freien Universität Berlin Philosophie und Linguistik. Seit 2003 arbeitet er als freier Publizist, Kultur- und Wissenschaftsjournalist und veröffentlicht zu Themen der Kultur- und Ideengeschichte. Seit Juni 2013 ist Alexander Grau Kolumnist bei »CICERO-online«, wo er sich wöchentlich mit Fragen des politischen und gesellschaftlichen Zeitgeistes auseinandersetzt. Zuletzt ist von ihm erschienen »Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung« (2017).
ALEXANDER GRAU
Kulturpessimismus
Ein Plädoyer

Inhalt
Einleitung
DER Kulturpessimismus ist tot. Er gilt als überholt und unzeitgemäß, als ein angestaubtes Relikt aus einer Zeit, als elitäre Bildungsschnösel mit unverhohlener Verachtung auf die aufkommende Populär- und Massenkultur schauten und geistige Biedermänner an jeder Ecke den Untergang des Abendlandes witterten.
Zudem gilt der Kulturpessimismus als widerlegt. Das Abendland ist nicht untergegangen, im Gegenteil. Nie ging es uns besser. Und das nicht nur materiell. Landauf, landab blüht das Kulturleben. Befreit von der Engstirnigkeit und den Ressentiments vergangener Epochen sind die westlichen Gesellschaften bunter, vielfältiger und demokratischer geworden. Was als Kultur gilt und was nicht, ist nicht länger abhängig von dem paternalistischen Diktat einer vermeintlichen Elite und ihren sterilen Normen. Kultur ist im Leben angekommen und entfaltet sich aus den verschiedenen Lebenswirklichkeiten einer pluralistischen Gesellschaft heraus. So entsteht Diversität und Spannung, wo früher nur Eintönigkeit und Ödnis herrschte – soweit zumindest das Fazit progressiver Kulturoptimisten.
Hinzu kommt, dass Kulturpessimismus keinen Spaß macht. Kulturpessimisten sind Miesepeter, übelgelaunte Griesgrame, die den Menschen nicht ihr Vergnügen gönnen, sondern überall den Kulturverlust fürchten, den Verfall der Sitten, des guten Geschmacks und des Anstandes. Kulturpessimisten sind die Spielverderber in einer Gesellschaft, in der das Spiel der höchste Lebenssinn geworden ist. Und schließlich sind Kulturpessimisten gefährlich. Sie verachten die Moderne und ihre Errungenschaften, also all jenes, auf das der moderne Mensch so unendlich stolz ist: Emanzipation, Individualismus, Freiheit. Deshalb sind Kulturpessimisten politisch suspekt. Sie stehen in dem Verdacht, vormodernen, autoritären und undemokratischen Gesellschaften hinterherzutrauern, Gesellschaften, in denen der Mensch nicht nach Selbstverwirklichung strebte, sondern Lebenssinn im Dienen fand, in denen nicht der einzelne zählte, sondern die Familie, das Volk, die Nation oder ein anderes Kollektiv.
Kurz: Kulturpessimisten umgibt der Schwefelgeruch des Antidemokraten, des Antiaufklärers und Liberalismusverächters. Solche Gestalten sind zumindest suspekt. Für einen aufgeklärten modernen Menschen haben ihre Analysen und Beobachtungen etwas Anrüchiges. Es gehört daher zum guten Ton, vor Kulturpessimismus zu warnen. Er sei, so der Vorwurf, eine hässliche Ideologie von Menschen, die gefangen sind in Ressentiments gegen die dynamische Welt der globalisierten Moderne.
Selbst auf seiten der politischen Linken finden sich daher keine ernsthaften Kulturpessimisten mehr, was um so erstaunlicher ist, als die Linke mit Theodor W. Adorno und der auf ihm aufbauenden Kritik des modernen Medien- und Massenkulturbetriebes den letzten profilierten kulturkritischen Denkansatz hervorgebracht hat. Doch die Linke hat ihren Frieden mit der Massenkultur gemacht, mit den Zumutungen der elektronischen Medien und der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Zu eng war die Verbindung linker Protestbewegungen der sechziger und siebziger Jahre mit der Popkultur, zu groß die Abneigung gegen alles, was als bürgerliche Herrschaftsinstrumente identifizierbar war. Also pflegte man einen rebellischen Kult des Antibürgerlichen und verschrieb sich der hedonistischen Zerstörung aller als einengend empfundenen Formen, Regeln und Normen.
Dass man sich dabei zum willfährigen Erfüllungsgehilfen einer globalen Massengüterindustrie machte und damit das förderte, was man zu bekämpfen vorgab, fiel den wenigsten auf. Im Namen von Selbstverwirklichung und individueller Lebensgestaltung machte die Linke so ihren Frieden mit den Produzenten massenhaft konsumierbarer Individualität. Die Systemkritik selbst wurde in Gestalt von Popmusik und Mode zum Massenprodukt. Der revolutionäre Habitus zu einer Pose, für den die Konsumgüter- und Unterhaltungsindustrie das Equipment zur Verfügung stellt.
Konsequenterweise wurde die Ironie zum intellektuellen Accessoire der Progressiven und Modernitätsgläubigen. Sie ermöglicht die bedingungslose Teilhabe an der kapitalistischen Massenkultur und den hedonistischen Konsum ihrer medialen und realen Produkte bei gleichzeitig zur Schau gestellter Distanz. Alles scheint legitimiert durch sein Selbstverwirklichungspotential und seinen Unterhaltungsfaktor. Zudem eröffnet Ironie als progressiv empfundene Lebenshaltung die Möglichkeit, gedankliche Faulheit und Unernst zu kaschieren. Den sensibleren Gemütern gestattet der ironische Gestus die Teilhabe an der postmodernen Massenkultur. Denn allein die ironische Haltung macht den alles nivellierenden Pankulturalismus erträglich. Sie ist das Anästhetikum des Geistes, um die Veränderungen der Moderne und der sie affirmierenden Ideologien überhaupt noch zu ertragen. Ironie aber, die im besten Fall einen intellektuellen Schutz darstellt und eine Methode, den Kulturzerfall in der Moderne wahrzunehmen, ohne in den Verdacht zu geraten, aus der Zeit gefallen zu sein, erstarrt zur traurigen Pose.
Eine Gesellschaft, zu deren Kultur die Affirmation von so ziemlich allem gehört, was als »Kultur« daherkommt und für die die Vorstellung, dass es kulturell Minderwertiges gibt, ein geradezu ketzerischer und skandalöser Gedanke ist, hat im Grunde jede Kritik von Kultur aufgegeben, auch wenn sie die Kulturkritik nach wie vor als leere Monstranz vor sich herträgt. Kultur wird so zur Nullformel, die, eben weil sie inhaltsfrei und beliebig ist, auch das Trivialste adelt. Vor dem Hintergrund der europäischen Kulturgeschichte ist das eine erstaunliche Entwicklung. Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörte es zu den unausgesprochenen Gewissheiten europäischer Gesellschaften, dass nicht alles, was Menschen geschaffen haben, auch das Prädikat Kultur verdient, dass es kulturelle Entwicklungen gibt und damit auch die Möglichkeit des Niedergangs einer Kultur. Mehr noch: Die Unterscheidung zwischen Kultur, Hochkultur und Nichtkultur und das Bewusstsein, dass Kulturen auch zerfallen können, war geradezu konstitutiv für das Selbstverständnis europäischer Kulturgesellschaften. Dieses traditionelle Kulturkonzept wurde im Zuge der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse der sechziger und siebziger Jahre endgültig aufgegeben, ideologisch flankiert durch die in dieser Zeit entstehenden Kulturwissenschaften. An die Stelle eines normativen Kulturbegriffs trat ein pan- und transkulturelles Kulturverständnis. Zugleich begann die zunehmende Desavouierung des Kulturpessimismus.
Der vorliegende Essay ist der Versuch, den Kulturpessimismus zu rehabilitieren. Das kann jedoch nicht einfach dadurch geschehen, dass man auf alte kulturpessimistische Analysen und Motive zurückgreift. Kulturpessimismus, der sich in Nostalgie erschöpft, ist nicht mehr als seine eigene Bestätigung. Hinzu kommt, dass die klassischen kulturpessimistischen Ansätze des 19. und 20. Jahrhunderts ihren Schlüsselbegriff seltsam unterbelichtet ließen: Man setzte einfach ein Alltagsverständnis von Kultur voraus, ohne dieses zu konkretisieren oder gar zu hinterfragen. Das Analyseinstrumentarium des klassischen Kulturpessimismus ist somit aus heutiger Sicht eher dürftig und erschöpft sich nicht selten in Ressentiments gegenüber der Moderne.
Aus diesem Grund beginnt der vorliegende Essay mit einer Beschreibung dessen, was Kultur ist. Kultur, so die These, ist zunächst ein Ordnungssystem, das der Mensch der unberechenbaren und bedrohlichen Natur entgegensetzt. Kultur ist Kontingenzbewältigung, sie strukturiert den Raum und die Zeit und ermöglicht damit Planbarkeit, Orientierung und Übersicht. Vor allem schafft sie einen Raum der Symbole, der die Möglichkeit eröffnet, natürlichen Gegenständen, Ereignissen und Artefakten eine über ihre eventuelle Nützlichkeit hinausgehende Bedeutung zuzusprechen. Die Welt bekommt eine zweite, symbolische Ebene. Das dabei entstehende Symbolsystem wirkt hochgradig normierend und damit stabilisierend. Kulturen homogenisieren, indem sie Autonomisierungsprozessen entgegenarbeiten. Erst die entstehende urbane Massengesellschaft der Industrialisierung schafft Bedingungen, die das normative Integrationspotential des Standardisierungssystems Kultur überstrapazieren. Kultur beginnt sich zu fragmentieren. Entsprechend verändert sich das Wertegefüge. Traditionelle Metanormen wie Stabilität, Beharrlichkeit und Kontinuität werden ersetzt durch Ideale wie Flexibilität, Spontaneität und Innovativität. Die Kulturdestabilisierung selbst wird zum Ideal und Kultur damit unmöglich. Die Gesellschaft tritt ein in die Ära der Postkulturalität. Da das Standardisierungszentrum sich unter dem Druck sozialer Mobilität aufgelöst hat, gibt es keine verbindlichen Normen mehr. Entsprechend etabliert sich eine Ideologie absoluter Toleranz. Alles gilt als wertvoll, der Pankulturalismus wird zur herrschenden Weltanschauung der postkulturellen Gesellschaft.
Zentral für diese Entwicklung war die Idee des Fortschritts. Wie im zweiten Kapitel des vorliegenden Essays zu zeigen versucht wird, ist das Konzept des Fortschritts und das damit verbundene Geschichtsbild eng an den Monotheismus geknüpft. Damit die Idee des Fortschritts jedoch tatsächlich die in ihr verankerte weltanschauliche Dynamik entfalten konnte, musste die Gesellschaft beginnen, sich tatsächlich zu verändern. Fortschritt wird zu einer universalhistorischen Kategorie und damit zeitlich entgrenzt. Fortschritt gibt es nicht punktuell, sondern die Geschichte an sich erweist sich als Fortschreiten. So kehrt die Heilsgeschichte in säkularem Gewand zurück.
Deutlich älter als die Idee des Fortschritts ist jedoch die Vorstellung vom Niedergang und kulturellen Zerfall. Es ist ein bezeichnendes anthropologisches Phänomen, dass quasi alle Mythen und Hochreligionen der Menschheit von einem goldenen Zeitalter zu berichten wissen, einem paradiesischen Zustand, der verloren gegangen ist und von dem die aktuelle Menschheit sich immer weiter entfernt. Doch Mythen sind Protohistorien. Zu einem tragenden gesellschaftlichen Bewusstsein säkularisierte der Niedergangsgedanke im Römischen Reich. Aus römischer Perspektive befand sich die eigene Kultur in einer Dauerabwärtsspirale, da sich die jeweils gegenwärtige Generation gegenüber den tugendhaften Ahnen als verweichlicht und dekadent erwies. Die römische Geschichte war aus Sicht ihrer Protagonisten eine Degenerationserzählung. Diesen Topos des Untergangs durch Dekadenz greift wirkmächtig Edward Gibbon auf, der damit der Moderne das zentrale Motiv ihrer Untergangsdiagnose schenkt. Denn bei allen Unterschieden im Detail läuft die kulturpessimistische Kritik im Kern auf das genannte Degenerationsmotiv hinaus.
Im vorliegenden Essay werden grob zwei kulturpessimistische Denkschulen unterschieden. Theoretiker wie Joseph de Maistre, Henri Massis, René Guénon, aber auch ihre scheinbaren Antipoden Paul de Lagarde und Julius Langbehn gehen von einem ideengeschichtlichen Sündenfall aus, der je nach Herkunft und Überzeugung in der Aufklärung, der Reformation, der unabgeschlossenen Romanisierung Europas oder dem Aufkommen abendländischer Philosophie in der Antike verortet wird und wie eine virulente Infektion schließlich unter den technischen Bedingungen der Moderne ausgebrochen sei.
Diesen ideologiegeschichtlichen Ansätzen stehen protosoziologische Theorien der Massengesellschaft gegenüber. In der Tradition Gustave Le Bons sieht insbesondere José Ortega y Gasset das Aufkommen der modernen Massengesellschaft als Ursache für den Zerfall traditioneller europäischer Kultur. Betont Ortega – ähnlich wie später Elias Canetti, Hendrik de Man und auch noch Theodor W. Adorno – vor allem den nivellierenden Charakter der industriellen Massengesellschaft, so war es der früh verstorbene Alfred Seidel, der, anknüpfend an Karl Mannheims Diagnose der modernen Pluralisierung der Denkstile, die abendländische Kultur vor einer entropieartigen Auflösung sieht. Ursache für diese Entwicklung sei das Bewusstsein für die Kontingenz der jeweiligen Weltsicht und die daraus folgende Heterogenisierung der Gesellschaft.
Mannheim und Seidel liefern damit die Schlüsselbegriffe zum Verständnis der Moderne und die zentrale Diagnose für einen aufgeklärten Kulturpessimismus. Ging der traditionelle Kulturpessimismus von einer Angleichung, Einebnung und damit verbundenen Verflachung abendländischer Kultur aus, so wird im Abschlusskapitel des vorliegenden Essays dafür argumentiert, dass die europäische Kultur an ihrer Pluralisierung und Fragmentierung zugrunde gegangen ist, letztlich also an den Bedingungen der technischen und industriellen Moderne.
Fixiert auf einen diffusen Kulturbegriff, der vermutlich im Wesentlichen den hochkulturellen Kanon des 19. Jahrhunderts und eine Reihe von sozialen Regeln umfasste, maß der klassische Kulturpessimismus den Niedergang von Kultur am Wegfall konkreter kultureller Normen. Das ist verständlich, aber zu kurz gedacht. Kultur oder Nichtkultur misst sich zunächst nicht an konkreten kulturellen Erscheinungen, der handwerklichen Kunst der Künstler, der literarischen Raffinesse der Literaten oder der Komplexität der Musik. Allerdings führt die Auflösung der Normierungskraft des Standardisierungssystems zwangsläufig zu einer Heterogenisierung der Kultur. Aus der Kultur werden »die Kulturen«.
Auch das müsste noch nicht zwangsläufig zu einem Kulturzerfall führen. In Verbindung mit den sozialen Umwälzungsprozessen der Industrialisierung jedoch, mit dem entstehenden Massenwohlstand und der damit einhergehenden Kaufkraft kommt es zu einer umfassenden Demontage kulturermöglichender, kulturstabilisierender und kulturgenerierender Strukturen. Denn Kultur, auch die sinnlichste und barockste, basiert auf Verzicht und Askese. Schon Freud wusste, dass Kultur das Produkt einer Triebsublimation ist. Als Standardisierungssystem besteht sie aus einem komplexen System rigider Regeln der Symbolanwendung. Kultur und grenzenlose individuelle Selbstverwirklichung schließen daher einander aus, denn Kultur engt ein.
Doch Kultur ist mehr als ein normierendes Symbolsystem. Sie schafft Bedeutung, indem sie den vergänglichen und endlichen, also allen Produkten menschlichen Tuns und letztlich dem Menschen selbst, Bedeutung verleiht. Das Symbolsystem Kultur fügt der Welt der Dinge, Tatsachen und Ereignisse eine Sinnebene hinzu. Hier, auf dieser Sinnebene, versucht der Mensch symbolisch seine Endlichkeit zu überwinden, indem er dem Zufälligen, Chaotischen und Vergänglichen der Natur Regeln, Ordnung und den Anspruch auf Ewigkeit entgegensetzt. In der Kultur transzendiert der Mensch sich selbst. Sie ist Ausdruck der metaphysischen Revolte (Albert Camus) des Menschen gegen seine Sterblichkeit, der absurde Versuch, Unendlichkeit zu schaffen. Deshalb auch sind Kulturen Heldensysteme (Ernest Becker), in deren Symbolwelt der Einzelne zum unsterblichen Helden werden kann und zugleich Bilder, Epen, Opern, Balladen und Filme von Helden erzählen. Aber auch die Kultur als Ganzes ist heroisch im Sinne des Versuchs, die Endlichkeit menschlicher Existenz zu überwinden. Daher ist es nur konsequent und kohärent, dass postheroische Gesellschaften zugleich auch postkulturelle Gesellschaften sind.
Kultur will Ewigkeit, der Mensch der industriellen Moderne will jedoch das Jetzt und Hier. Kultur ist der Preis, den wir hedonistischen, friedfertigen Individualisten für unseren Lebensstil zu zahlen haben. Dieser Preis ist hoch. Doch wir erlangen für ihn ein nie gekanntes Maß an Wohlstand, Sicherheit und Gewaltfreiheit. Aufgrund der spezifischen Verfasstheit von Kultur ist es ein Irrglaube anzunehmen, Kultur sei mit einer zivilisierten, humanen, sozialen Wohlstandsgesellschaft vereinbar. Diese zerfällt in hoch disparate Lebenswelten, die ihre Postkulturalität als Multikulturalität affirmieren. Dabei darf man sich keine Illusionen machen: Die Entstehung der industriellen und spätindustriellen Wohlstandsgesellschaft geht mit einem echten Kulturverlust einher, nicht etwa mit einer Transformation oder einem Umbau dessen, was einmal Kultur war. Und dieser Verlust ist nicht nur ein ästhetischer oder ein Verlust an Tiefe oder Feingeistigkeit, wie traditionelle Kulturpessimisten orakelten, sondern ein handfester Verlust an Menschlichkeit. Die metaphysische Revolte Camus’ findet zumindest in dem, was einmal der abendländische Kulturbereich war, nicht mehr statt. Das Bedürfnis, die eigene Sterblichkeit zumindest symbolisch zu überwinden und sich so heroisch gegen die eigene Sterblichkeit aufzulehnen, ist einer Verklärung und Feier der Diesseitigkeit gewichen.
Gefangen zwischen dem unhintergehbaren Bedürfnis nach gelebter Individualität und dem Bewusstsein der damit verbundenen Kosten in Gestalt der Auflösung der abendländischen Kultur bleibt dem Menschen der Spätmoderne nur ein aufgeklärter Kulturpessimismus. Darunter verstehe ich das Wissen, dass der Westen in eine nachkulturelle Phase eingetreten ist, dass dieser Zerfall tatsächlich einen Untergang, einen Verlust dramatischen Ausmaßes markiert, dass diese Kulturhavarie aber dennoch unausweichlich ist, wenn man zentrale Werte der Aufklärung nicht preisgeben will.
Der Kulturpessimismus ist nicht widerlegt. Nur weil eine Gesellschaft ihren eigenen kulturellen Niedergang nicht mehr wahrnimmt oder sogar noch als Fortschritt begreift, bedeutet das nicht, dass es diesen Niedergang nicht gibt. Mehr noch: Die Umdeutung von Auflösungssymptomen als Fortschritt stellt eine spezifische Form kulturellen Zerfalls dar. Die größte Gefahr, die westlichen Gesellschaft droht, entstammt nicht dem Arsenal des Kulturpessimismus, sondern der bedingungslosen Affirmation des Vorhandenen. Dies gilt um so mehr, als die klassische Kulturkritik zur Simulation ihrer selbst verkommen ist. Denn Kulturkritik im Zeitalter ihrer Vortäuschung besteht im Wesentlichen darin, das schon Gegebene zu fordern, nur noch radikaler und mit mehr Intensität.
Folglich hinterfragt der systemkonforme Querdenker aus dem Kultur- und Kunstbetrieb weder die herrschende Ideologie noch ihre gesellschaftlichen Manifestationen, deren Teil er ist, sondern kritisiert vielmehr ihre nur unzureichende Umsetzung. Konsequenterweise erschöpft sich sein Forderungskatalog in einer Liste des Mehr: mehr Offenheit, mehr Toleranz, mehr Internationalität, mehr Solidarität. So gerät institutionalisierte Systemkritik in einem System, das sich einbildet, kritisch zu sein, zur leeren Pose, auch und gerade weil Kritik, die zur Systemräson geworden ist, nur mehr Bestätigung der herrschenden Ideologie ist. Wo jedoch Kulturkritik zur Affirmation degeneriert, wird Kulturpessimismus zur letzten kritischen und aufgeklärten Option. Aufgeklärter Kulturpessimismus stellt daher auch keine politische Gefahr dar, sondern eine politische Chance. Er zerreißt den Vorhang autoaggressiver Selbstgefälligkeit, in der die westlichen Gesellschaften sich eingerichtet haben, und macht den Blick frei auf ihre Verfasstheit und ihren inneren Zustand.
Wenn Fritz Stern den Kulturpessimismus in seiner bekannten Schrift als Gefahr für Demokratie und Liberalismus deutet, so deshalb, weil er Kulturpessimismus mit revolutionärem Nationalkonservatismus gleichsetzt. Aber das ist stark vereinfachend. Zum einen, weil sich die Frage stellt, inwiefern Revolutionäre wie etwa Arthur Moeller van den Bruck, der zudem ausgesprochen modernistische Züge trug, überhaupt als Kulturpessimisten einzuordnen sind. Vor allem aber, weil Stern Kulturpessimismus mit einem unanalytischen, romantischen Idealismus gleichsetzt, einer »Art Lebensgefühl, ein Gefüge von Empfindungen und Werten, das die gebildeten Schichten aus gemeinsamen geistigen Traditionen ererbt und allmählich ihrer Stellung in der Gesellschaft angepasst hatten.«1
Stern trifft hier zwar ganz gut die Stimmung des Fin de Siècle, die sich etwa in dem Bildungsbürgermilieus Europas ab den 1880er Jahren breitmachte, und die sich etwa bei Julius Langbehn widerspiegelt. Gerade deshalb historisiert er den Kulturpessimismus als Haltung des bürgerlichen Zeitaltes und diskreditiert ihn damit unter der Hand als mögliche, gut begründete kulturphilosophische Haltung. Dieser Historisierung des Kulturpessimismus möchte der vorliegende Essay widersprechen.
Nicht wenige Leser werden sich früher oder später fragen, weshalb hier nicht der Name auftaucht, den man, zumindest in Deutschland, wie keinen andereren mit dem Begriff des Kulturpessimismus verbindet: Oswald Spengler. Das liegt darin begründet, dass Spengler kein Kulturpessimist ist. Inspiriert durch die spätromantische, vor allem von Schelling beeinflusste Weltalterphilosophie Ernst von Lasaulx’ und Hegels Geschichtsphilosophie, präsentiert Spengler eine Theorie zyklischer Geschichtsprozesse: Angelehnt an die Lebensphasen von Organismen, durchlaufen Kulturen Stadien der Jugend, der Reife und des Alters, sie werden groß, gedeihen, erblühen, erreichen eine Phase maximaler Entfaltung und vergehen danach schrittweise. Diese kulturhistorischen Prozesse laufen gesetzmäßig ab. Der Untergang ist somit kein Privileg des Abendlandes. Und vermeidbar ist er auch nicht. Spengler versteht seine Morphologie der Geschichte daher auch ausdrücklich als »Philosophie der Zukunft«2, also als den Versuch, »Geschichte vorauszubestimmen.«3 Auch wenn Spengler dem Abendland den Untergang prophezeit – übrigens nicht in seiner unmittelbaren Zukunft, sondern zweihundert Jahre später –, so ist seine Geschichtsphilosophie so wenig pessimistisch wie diejenige Hegels. Unter den hier analysierten kulturpessimistischen Autoren hätte er sich also eher fremd ausgenommen.
Dass Spengler hier so schnöde übergangen wird, ist daher auch nicht Ausdruck modischer Geringschätzung, im Gegenteil. Seine Geschichtsmorphologie mutet heutzutage grotesk an. Spenglers pluralistischer Kulturrelativismus jedoch ist angesichts der Debatten um einen möglichen Kampf der Kulturen (Samuel Huntington) hochaktuell und zugleich eine Mahnung. Denn die insbesondere bei den heutigen Eliten in Politik, Wirtschaft und Kultur so beliebte Annahme vom Sieg einer liberalen Universalkultur erschiene aus seiner Sicht absurd und gefährlich. So gesehen ist der vorliegende Essay durchaus im Geist Spenglers geschrieben.
1 Stern 2005, S. 17 f.
2 Spengler 1923, S. 6.
3 Ebd., S. 3.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.