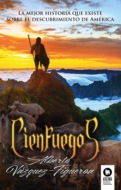Buch lesen: "Tuareg"
Tuareg
Alberto Vázquez–Figueroa

Kategorie: Romane | Bibliothek: Alberto Vázquez-Figueroa
Originaltitel: Tuareg
Erstausgabe: 1980
Aktualisierte und erweiterte Neuauflage: Oktober 2020
© 2020 Redaktion Kolima, Madrid
www.editorialkolima.com
Autor: Alberto Vázquez-Figueroa
Titelbild: Silvia Vázquez-Figueroa
ISBN: 978-84-18811-42-5
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Werkes ist nicht gestattet, noch seine Einbindung in ein Computersystem oder seine Übertragung in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder andere Methoden, Vermietung oder eine andere Form der Übertragung des Werkes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Inhaber des geistigen Eigentums.
Jegliche Form der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe oder Umwandlung dieses Werkes darf nur mit Genehmigung seiner Eigentümer durchgeführt werden, sofern dies nicht gesetzlich vorgesehen ist. Wenden Sie sich an CEDRO (Spanisches Zentrum für Vervielfältigungsrechte), wenn Sie ein Fragment dieses Werks fotokopieren oder scannen möchten (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 45).
Zu meinem Vater
Allah ist groß. Er sei gepriesen!
Vor vielen Jahren, als ich jung war und meine Beine mich tagelang über Sand und Gestein hinweg zu tragen vermochten, ohne Müdigkeit zu verspüren, erfuhr ich irgendwann, mein jüngerer Bruder sei krank geworden. Obwohl drei Tagesmärsche seine khaima von meiner trennten, war die Liebe stärker als die Trägheit. Ohne Furcht machte ich mich auf den Weg, denn wie gesagt: ich war jung und stark, und ich ließ mich durch nichts entmutigen. Am zweiten Tag erreichte ich in der Abenddämmerung ein Gebiet mit sehr hohen Dünen, eine halbe Tagesreise vom Grab des Heiligen Omar Ibrahim entfernt. Ich erkletterte eine der Dünen mit der Absicht, nach menschlichen Behausungen Ausschau zu halten und dort um Gastfreundschaft zu bitten. Da ich jedoch nichts entdeckte, beschloß ich, die Nacht im Windschatten der Düne zu verbringen.
Der Mond hätte schon hoch am Himmel stehen müssen - hätte es Allah nicht gefallen, ihn in jener Nacht zu verbergen -, als ich von einem so unmenschlichen Schrei geweckt wurde, daß ich fast den Verstand verlor und mich, von panischer Angst gepackt, zusammenkauerte. So verharrte ich, und der gräßliche Schrei ertönte ein zweites Mal, gefolgt von so zahlreichen Klagelauten, daß ich unwillkürlich an die Seele eines Verdammten denken mußte, die mit ihrem Geheul die Erde zu durchdringen vermochte. Plötzlich hörte ich, wie jemand im Sand scharrte,und dann verstummte das Geräusch, um gleich darauf an anderer Stelle erneut hörbar zu werden. Dies wiederholte sich an fünf oder sechs Orten, und die ganze Zeit nahm das herzzerreißende Klagen kein Ende. Vor Angst hätte ich mich am liebsten verkrochen, und ich zitterte am ganzen Körper.
Doch das war noch nicht alles, was ich zu erdulden hatte, denn unversehens vernahm ich ein mühseliges Keuchen - und dann warf mir jemand eine Handvoll Sand nach der anderen ins Gesicht. Meine Vorfahren mögen mir verzeihen, aber ich gestehe, daß ich, von wahnwitziger Furcht gepackt, aufsprang und davonrannte, als wäre mir der leibhaftige saitan, der gesteinigte Unhold, auf den Fersen. Meine Schritte verlangsamten sich erst, als die Sonne mir den Weg erhellte und die großen Dünen hinter mir am Horizont verschwunden waren.
Bald darauf gelangte ich zur khaima meines Bruders, dessen Zustand sich nach dem Willen Allahs so sehr gebessert hatte, daß er sich meine Schilderung der Schreckensnacht anhören konnte. Als ich die Geschichte genauso erzählt hatte, wie ich sie euch gerade erzählt habe, lieferte mir ein Nachbar die Erklärung für jenen Vorfall, indem er an mich weitergab, was er einst von seinem Vater erfahren hatte.
Und dies waren seine Worte:
>Allah ist groß. Er sei gepriesen!
Vor vielen Jahren gab es zwei mächtige Familien, die Zayed und die Atman. Sie haßten sich, und sie hatten schon soviel Blut vergossen, daß sie damit für alle Zeiten ihr Vieh hätten rot färben können. Das bislang letzte Opfer war ein junger Atman gewesen, und deshalb sann seine Familie auf Rache. Eines Tages geschah es, daß die Zayed in den Dünen, wo du geschlafen hast,unweit des Grabes des Heiligen Omar Ibrahim, ihre khaima aufschlugen. Alle
Männer waren umgekommen, und so lebte in dem Zelt nur noch eine Mutter mit ihrem Sohn. Die beiden wähnten sich in Sicherheit, denn sogar bei Familien, die sich sehr haßten, galt es als unwürdig, sich an einer Frau und an einem Kind zu vergreifen.
Eines Nachts erschienen jedoch die Feinde. Sie fesselten die arme Mutter, die stöhnte und weinte. Ihren kleinen Sohn nahmen sie mit, denn sie hatten vor, ihn lebendig in einer der Dünen zu begraben.
Die Fesseln waren stark, aber bekanntlich gibt es nichts Stärkeres als die Liebe einer Mutter. Es gelang der Frau, sich zu befreien, doch als sie ins Freie trat, hatten sich schon alle davongemacht. Sie erblickte lediglich eine Unzahl hoher Dünen, und sie lief von einer zur anderen, scharrte im Sand und rief nach ihrem Sohn, wissend, daß er innerhalb kürzester Zeit ersticken würde und daß sie die einzige war, die ihn retten konnte.
Als der Morgen graute, suchte sie noch immer. Sie suchte auch noch am nächsten Tag und am übernächsten, denn Allah hatte ihr in seiner Milde die Wohltat des Wahnsinns erwiesen, damit sie weniger litte und nicht verstünde, wieviel Bosheit in den Menschen wohnt.
Die unglückliche Frau wurde nie wieder gesehen, aber es heißt, daß sich ihr Geist nachts in den Dünen unweit des Grabes des Heiligen Ibrahim herumtreibt,jammernd und unablässig suchend. So scheint es tatsächlich zu sein, denn du selbst hast dort ahnungslos geschlafen und bist ihr begegnete«
»Gelobt sei Allah, der Barmherzige, der dir gestattet hat, wohlbehalten zu entkommen, deine Reise fortzusetzen und hier in unserem Kreise am Feuer zu sitzen.«
»Er sei gelobt!«
Der Alte seufzte laut und vernehmlich. Dann wandte er sich an die jüngeren seiner Zuhörer, die die alte Geschichte heute zum ersten Mal vernommen hatten, und sagte: »Ihr seht also, daß Haß und Streit zwischen Familien zu nichts führen, es sei denn zu Angst, Wahnsinn und Tod. Glaubt mir, in den vielen Jahren, die ich an der Seite der Meinigen im Kampf gegen die Ibn-Aziz, unsere Erzfeinde aus dem Norden, verbraucht habe, vermochte ich darin nie etwas Gutes zu sehen, das als Rechtfertigung hätte dienen können, denn die Räubereien der einen werden mit den Raubzügen der anderen bezahlt und die Toten auf beiden Seiten haben keinen
Preis, sondern sie führen nur dazu, daß es noch mehr Tote gibt, bis es in den khaimas an starken Armen mangelt und die Söhne ohne die Stimme des Vaters aufwachsen.«
Minutenlang schwiegen alle, denn sie mußten über die Lehren nachdenken, die die Geschichte des alten Suilem enthielt. Sie sofort zu vergessen, wäre ungehörig gewesen, denn dann hätte ein so geachteter Mann vergeblich Stunden seines Schlafes geopfert und um seiner Zuhörer willen seine Kräfte verausgabt.
Schließlich gab Gacel, der jene alte Geschichte schon viele Dutzend Male gehört hatte, mit einer Handbewegung das Zeichen, daß es nun Zeit war, sich zur Ruhe zu begeben. Dann ging er allein fort, wie er es jeden Abend tat, um zu prüfen, ob das Vieh zusammengetrieben worden war, ob die Sklaven seine Befehle ausgeführt hatten, ob seine Familie friedlich schlief und ob in seinem kleinen »Reich«
Ordnung herrschte. Dieses Reich bestand aus vier Kamelhaarzelten, einem halben Dutzend seribas aus miteinander verflochtenem Schilfrohr, einem Brunnen, neun Palmen und ein paar Ziegen und Kamelen. Danach erkletterte er ohne Hast - auch dies tat er jeden Abend - die hohe, feste Düne, die sein Lager gegen die Ostwinde schützte. Im Mondschein betrachtete er von dort oben den Rest seines Reiches: die sich endlos erstreckende Wüste, ungezählte Tagesmärsche durch Sand, über Gestein, Berge und Geröllhalden hinweg. Hier herrschte er, Gacel Sayah, mit absoluter Macht, denn er war der einzige amahar, der sich in dieser Gegend niedergelassen hatte - und außerdem gehörte ihm der einzige Brunnen weit und breit.
Er saß gern auf jenem Gipfel und dankte Allah für die tausendfachen Segnungen, mit denen er überschüttet worden war: eine wohlgeratene Familie, gesunde Sklaven, gutes Vieh, fruchtbringende Palmen und das höchste Geschenk, nämlich aufgrund seiner Geburt zu den Edlen der kel-tagelmust, zu den »Männern mit dem Schleier« zu gehören, also zu den unbezähmbaren imohar, die bei anderen Sterblichen unter dem Namen tuareg bekannt waren.
Nach Süden, Osten, Norden und Westen gab es nichts - nichts, das die Macht von Gacel, dem »Jäger«, hätte einschränken können. Nach und nach hatte er sich immer weiter von den bewohnten Gegenden entfernt, um sich weitab in der Wüste niederzulassen. Dort konnte er ganz allein sein mit seinen wilden Tieren: den scheuen Mendesantilopen, denen er tagelang unten in der Ebene auflauerte; den Mähnenscharen auf den hohen, sich vereinzelt aus dem Sandmeer erhebenden Bergen; den Wildeseln, Wildschweinen, Gazellen und den riesigen Schwärmen der Zugvögel. Gacel war vor der stetig vorrückenden Zivilisation geflohen, hatte sich der Macht der Eindringlinge und der wahllosen Ausrottung der Wüstentiere zu entziehen versucht. Überall in der Sahara, von Timbuktu bis zu den Ufern des Nils, galt seine Gastfreundschaft als beispiellos, aber er stürzte sich auch voller Wut auf die Karawanen der Sklavenhändler, die unbesonnen genug waren, sich auf sein Territorium vorzuwagen.
»Mein Vater hat mich gelehrt«, sagte er, »immer nur eine einzige Gazelle zu töten,auch wenn die Herde dann flieht und es drei Tage kostet, sie wieder einzuholen. Ich kann mich von drei Tagesmärschen erholen, aber niemand kann eine unnötig getötete Gazelle wieder zum eben erwecken.«
Gacel wurde Zeuge, wie die Franzosen im Norden des Landes die Antilopen und fast überall im Atlasgebirge die Mähnenschafe ausrotteten. In der hammada, auf der anderen Seite der großen seguia, die vor Tausenden von Jahren ein wasserreicher Fluß gewesen war, verschwanden nach und nach die schönen Mendesantilopen. Deshalb hatte er sich für diese entlegene Gegend hier entschieden, die aus Geröllhalden, endlosen, sandigen Ebenen und schroffen Bergen bestand, vierzehn Tagesmärsche von El-Akab entfernt. Niemand außer ihm, Gacel, erhob Anspruch auf diesen unwirtlichsten Teil der unwirtlichsten aller Wüsten.
Für immer waren die glorreichen Zeiten vorbei, in denen die Tuareg Karawanen überfielen oder mit lautem Geheul französische Truppen angriffen. Auch die Tage der Raubzüge voller Kampf und Tod gehörten der Vergangenheit an. Damals hatten die Tuareg frei wie der Wind die Wüste durchstreift. Stolz hatten sie sich »Freibeuter der Wüste« und »Herren der Sahara« nennen lassen, vom südlichen Atlas bis zu den Ufern des Tschad-Sees. Vergessen waren die Bruderkriege von einst und die Gefechte, an die sich die Alten noch immer gern erinnerten. Damals hatte der Niedergang der imohar, der »Freien«, begonnen. Einige der tapfersten Krieger wurden bei den Franzosen Lastwagenfahrer, andere wurden Soldaten bei der regulären Truppe oder verkauften Stoffe und Sandalen an Touristen in grellbunten emden.
An dem Tag, als sein Vetter Suleiman der Wüste den Rücken kehrte, um in der Stadt zu leben und für Geld stundenlang Ziegelsteine zu schleppen, schmutzig und von Zementstaub bedeckt - an jenem Tag begriff Gacel, daß er fliehen mußte, um der letzte, ganz auf sich gestellte targi zu werden.
Und so war er nun hier, und mit ihm war seine Familie. Tausendmal hatte er Allah schon dafür gedankt, denn in all den Jahren - es waren so viele, daß er sie nicht mehr zu zählen vermochte - hatte er seinen Entschluß nicht ein einziges Mal bereut, wenn er allein des Nachts auf dem Gipfel der Düne saß und nachdachte.
In der Welt hatten sich während dieser Zeit seltsame Dinge zugetragen, die als wilde Gerüchte bis zu Gacel ‘ drangen, wenn er einem der wenigen Reisenden begegnete. Er freute sich, daß er all dies nicht aus nächster Nähe miterlebt hatte, denn die längst überholten Nachrichten sprachen von Tod und Krieg, von Haß und Hunger, von großen Umwälzungen, die sich immer mehr beschleunigten, von Veränderungen, auf die niemand stolz sein konnte und die auch für niemanden Gutes verhießen.
Eines Nachts, als er dort oben saß und die Sterne betrachtete, die ihm schon so oft den Weg durch die Wüste gewiesen hatten, entdeckte er plötzlich ein neues, strahlend helles Gestirn, das mit großer Geschwindigkeit eine Bahn über den Himmel zog, zielstrebig und unaufhaltsam, jedoch ohne die wahnwitzige Hast der flüchtigen Sternschnuppen, die unversehens aufleuchteten, um sofort wieder im Nichts zu verschwinden. Zum erstenmal hatte
Gacel das Gefühl, daß ihm das Blut in den Adern erstarrte, denn weder in seinem eigenen Gedächtnis noch in der Überlieferung seiner Vorfahren oder in den alten Legenden war die Rede von einem Himmelskörper, der Nacht für Nacht erschien und immer denselben Kurs über den Himmel verfolgte.
Im Lauf der Jahre kamen dann viele andere hinzu, bis sie eine rastlose Meute bildeten, die den uralten Frieden des Firmaments störte. Welche Bewandtnis es mit ihnen hatte, vermochte er nicht in Erfahrung zu bringen - er nicht und auch nicht der alte Senegalese Suilem, der Vater von fast all seinen Sklaven. »Noch nie sind die Sterne so verrückt über den Himmel gehuscht, Herr«, meinte Suilem. »Niemals zuvor war es so, und das kann bedeuten, daß sich das Ende der Zeiten nähert.«Gacel befragte einen Reisenden, der ihm jedoch keine Antwort zu geben vermochte. Er fragte noch einen zweiten, und dieser meinte zögernd und voller Zweifel: »Ich glaube, daß die Franzosen dahinterstecken.«Daran mochte Gacel jedoch nicht glauben. Er hatte zwar viel von den Erfindungen der Franzosen gehört, doch hielt er sie nicht für so verrückt, daß sie ihre Zeit damit verschwenden könnten, den Himmel mit noch mehr Sternen zu füllen. »Es muß sich um ein göttliches Zeichen handeln«, sagte er sich. »Es ist wohl ein Hinweis,daß Allah uns etwas mitteilen will - aber was?«Er mühte sich, im Koran eine Antwort zu finden, aber im Koran stand nichts über Sternschnuppen von mathematischer Präzision. So fand er sich denn im Lauf der Zeit mit ihnen ab und gewöhnte sich an ihren Anblick, was nicht heißen soll, daß er sie fraglos hinnahm.
In der klaren, reinen Luft der Wüste, in der finsteren Nacht dieses Landes, in dem in einem Umkreis von Hunderten von Kilometern kein anderes Licht zu sehen wa,hätte man glauben mögen, daß das gestirnte Firmament so weit herabreichte, daß es fast den Wüstensand streifte. Oft streckte Gacel die Hand aus, als könnte er mit den Fingerspitzen jene funkelnden Lichter berühren. Lange saß er so da, allein mit seinen Gedanken. Später stieg er dann ohne Eile hinab, um einen letzten Blick aufdas Zeltlager und das Vieh zu werfen. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß keine hungrigen Hyänen und schlauen Schakale seine kleine Welt bedrohten, war es auch für ihn Zeit, sich schlafen zu legen.
Am Eingang seines Zeltes, dem größten und bequemsten von allen, blieb er kurz stehen und lauschte. Sofern das Klagen des Windes noch nicht zu vernehmen war, verdichtete sich die tiefe Stille so sehr, daß sie sogar dem Gehör eines Menschen schädlich sein konnte.
Gacel liebte diese Stille.
Jeden Morgen sattelte der alte Suilem oder einer seiner Enkel das Lieblingskamel seines Herrn, des amahar Gacel, und wartete damit vor dem Eingang des Zeltes.
Jeden Morgen ergriff der Targi sein Gewehr, kletterte auf den Rücken des langbeinigen mehari und ritt in eine der vier Himmelsrichtungen davon, um nach
Wild Ausschau zu halten.
Gacel liebte sein Kamel, wie nur ein Mann der Wüste ein Tier zu lieben vermag,von dem oft sein Leben abhängt. Heimlich, wenn ihn niemand hören konnte, redete er mit dem Kamel, als könnte es ihn verstehen. Er nannte es r’orab, den Raben, und spottete auf diese Weise über das besonders helle Fell, das oftmals kaum vom Wüstensand zu unterscheiden war, so daß das Tier vor dem Hintergrund einer hohen Düne fast unsichtbar war.
Diesseits von Tamanrasset gab es kein schnelleres und ausdauernderes Mehari. Ein reicher Kaufmann, Herr über eine Karawane von mehr als dreihundert Tieren, hatte Gacel einmal fünf Kamele für das Mehari geboten, aber Gacel war nicht darauf eingegangen. Er wußte, daß R’Orab das einzige Kamel der Welt war, das ihn in der sogar finstersten Nacht zu seinem Zeltlager zurückbringen konnte, falls ihm eines Tages bei einem seiner einsamen Streifzüge etwas zustoßen sollte. Häufig schlief er ein, vom schaukelnden Gang des Tieres gewiegt und von Müdigkeit übermannt, und mehr als einmal geschah es, daß seine Familie ihm am Eingang seiner khaima aus dem Sattel half und ihn zu seinem Schlaflager geleitete.
Die Franzosen behaupteten, Kamele seien dumme, grausame und rachsüchtige Tiere, deren Gehorsam man durch Schreie und Schläge erzwingen müsse, doch ein echter amahar wußte, daß ein gutes Wüstenkamel, besonders ein reinrassiges, bestens gepflegtes und abgerichtetes Mehari, so treu und klug wie ein Hund sein konnte, aber natürlich tausendmal nützlicher in dieser Landschaft aus Sand und Wind.
Das ganze Jahr über behandelten die Franzosen alle Kamele gleich, ohne zu begreifen, daß die Tiere in den Monaten der Brunft reizbar und gefährlich werden konnten, besonders wenn die Hitze mit den Ostwinden zunahm. Deshalb wurden die Franzosen in der Wüste nie gute Reiter, und deshalb gelang es ihnen nie, die Tuareg zu beherrschen, sondern sie wurden von diesen in den Jahren der Kämpfe und Fehden immer wieder besiegt, obwohl sie in der Überzahl und besser bewaffnet waren.
Später gelang es dann den Franzosen, die Oasen und Brunnen unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie verschanzten sich mit ihren Kanonen und Maschinengewehren an den wenigen Wasserstellen im flachen Land. Die »Söhne des Windes«, jene freien, unbezähmbaren Reiter, mußten sich vor etwas beugen, das seit Anbeginn der Zeiten ihr ärgster Feind gewesen war: der Durst. Aber die Franzosen empfanden keinen Stolz, die »Männer mit dem Schleier«besiegt zu haben, denn in Wirklichkeit gelang es ihnen nicht, sie in einem offenen Krieg niederzuzwingen. Weder Schwarze aus dem Senegal noch Lastwagen oder gar Panzer vermochten etwas in einer Wüste auszurichten, die von einem Ende bis zum anderen von den Tuareg mit ihren Meharis beherrscht wurde.
Die Tuareg waren nicht sehr zahlreich und lebten zudem weit verstreut,wohingegen die Soldaten aus der Hauptstadt oder aus anderen Kolonien wie Heuschreckenschwärme einfielen. Eines Tages war es soweit, daß in der Sahara kein Kamel, kein Mann, keine Frau und kein Kind an einem Brunnen trinken konnte, ohne die Franzosen um Erlaubnis zu fragen.
An jenem Tag legten die imohar die Waffen nieder, weil sie nicht mitansehen konnten, wie ihre Familien zugrunde gingen. Von da an waren sie dazu verurteilt, in Vergessenheit zu geraten. Sie waren nun ein Volk ohne Daseinsberechtigung, denn man hatte ihnen die Grundlagen ihrer Existenz entzogen: Freiheit und Kampf.
Aber noch lebten hier und dort einzelne Familien wie diejenige von Gacel. Sie hausten irgendwo in den Weiten der Wüste, doch ihnen gehörten nicht mehr Scharen von stolzen, hochmütigen Kriegern an, sondern es gab nur noch Männer, die in ihrem Inneren aufbegehrten und im übrigen die Gewißheit hatten, daß sie nie wieder die gefürchteten Männer des Schleiers, des Schwertes und der Lanze sein würden.
Dennoch waren die imohar auch weiterhin die Herren der Wüste, von der hammada bis zum erg oder zu den windgepeitschten, hohen Bergen. Die echte Wüste bestand nämlich nicht aus den spärlichen Oasen und Brunnen, sondern aus Tausenden von Quadratkilometern in ihrem Umkreis. Fernab der Wasserstellen gab es keine Franzosen, keine senegalesischen Askaris, ja nicht einmal Beduinen, denn da diese die Sandwüsten und steinigen Ebenen nicht kannten, hielten sie sich an die Karawanenwege, die von Oase zu Oase, von einer menschlichen Siedlung zur nächsten führten. Die Beduinen fürchteten die unermeßliche Weite dieses Landes.
Einzig die Tuareg, und ganz besonders die Einzelgänger unter ihnen, wagten sich ohne Furcht ins »Land der Leere«, das auf den Landkarten als weißer Fleck verzeichnet war. An heißen Tagen herrschte dort mittags eine Temperatur, die das Blut zum Kochen brachte. Hier gediehen nicht einmal die zähesten aller Dornenbüsche, und sogar die Zugvögel flogen in großer Höhe über dieses Gebiet hinweg.
Gacel hatte in seinem Leben schon zweimal einen solchen weißen Fleck, ein »Land der Leere« durchquert. Das erste Mal war es ein Tapferkeitsbeweis gewesen. Er wollte zeigen, daß er ein würdiger Nachfahre des legendären Turki war. Das zweite Mal - er war inzwischen ein erwachsener Mann - ging es ihm darum, sich selbst zu beweisen, daß er noch immer derselbe Gacel war, der in jungen Jahren sein Leben riskiert hatte.
Die Wüste aus Sand, Sonne und Hitze, dieser trostlose, den Geist verwirrende Ofen, übte auf Gacel eine seltsame Faszination aus. Ihrem Zauber war er eines Abends vor vielen Jahren erlegen, als er im Schein des Feuers zum ersten Mal von der Großen Karawane hatte reden hören: Siebenhundert Männer und zweitausend Kamele waren von einem »weißen Fleck« verschluckt worden, und nie wieder hatte man eine Spur von Mensch und Tier gefunden.
Diese Karawane, die als die größte galt, die jemals von den reichen haussa- Kaufleuten zusammengestellt worden war, hatte sich auf dem Weg von Gao nach Tripoli befunden. Sie wurde geführt von den erfahrensten Kennern der Wüste.
Ausgewählte Meharis trugen auf ihren Rücken ein wahres Vermögen an Elfenbein, Ebenholz, Gold und Edelsteinen.
Ein Onkel zweiten Grades, nach dem Gacel benannt worden war, bewachte damals mit seinen Männern die Karawane. Auch er verschwand für immer, als hätte er nie existiert oder als wäre er nur eine Erscheinung in einem Traum gewesen.
In den Jahren danach wagten viele Männer das unsinnige Abenteuer, nach der verschollenen Karawane zu suchen, getrieben von der eitlen Hoffnung, in den Besitz von Reichtümern zu gelangen, die nach dem Buchstaben des Gesetzes dem gehörten, der sie dem Wüstensand entreißen konnte. Doch der Sand wahrte sein Geheimnis; er konnte alles zudecken und Städte, Festungen, Oasen, Männer und Kamele unter sich begraben. Von den Armen seines Verbündeten, des Windes,getragen, kam er mit unerwarteter Wucht daher und senkte sich über die Reisenden
in der Wüste, deckte sie zu und verwandelte sie in eine der zahllosen Dünen des erg.
Wie viele Männer an dem Traum zugrunde gingen, die sagenumwobene Karawane zu finden, das wußte niemand zu sagen, und die Alten warnten die jüngeren Männer immer wieder vor solch einem aberwitzigen Unternehmen.
»Was die Wüste haben will, das gehört ihr«, pflegten sie zu sagen.
»Allah schütze den, der versucht, ihr eine Beute zu entreißen ...«
Gacel hatte nur einen Wunsch: Er wollte hinter das Geheimnis kommen und den Grund erfahren, warum so viele Männer und Tiere spurlos verschwunden waren.
Als er sich zum ersten Mal bis ins Herz des »Landes der Leere« vorwagte, begriff er. Er konnte sich jetzt vorstellen, daß nicht nur siebenhundert, sondern auch sieben Millionen Menschen von dieser tischebenen Öde verschlungen werden könnten.
Verwunderlich wäre höchstens gewesen, wenn es überhaupt jemandem gelungen wäre, hier lebendig herauszukommen.
Gacel kam durch - zweimal! Aber es gab nicht viele imohar wie ihn, und deshalb achteten die »Männer des Schleiers« ihn, Gacel, den »Jäger«, den einsamen amahar, der sich in einem Land behauptete, das zu beherrschen sich noch nie ein anderer angemaßt hatte.