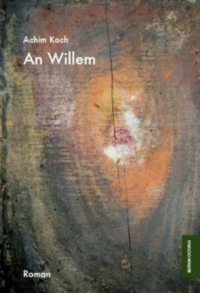Buch lesen: "An Willem"
An Willem
1 Titel Seite
Achim Koch An Willem
„E tukamst hiirt e dåmp.“
Momme Pedersen, 1826
1. Kleine Schritte zu mir
Nun wird es bald dunkel werden.
Ich liebe es, zu beobachten, wie das Licht langsam nachlässt. Bei dieser Dunkelheit und morgens in der schwachen Hellzeit spüre ich die vergangenen Jahre am besten.
In diesem Raum, den niemand außer Thor kennt, habe ich alles gehütet. Auch das alte Schießgerät von Anders. Es ist - wie immer - sauber geputzt und liegt glänzend vor mir auf dem grünen Filz. Lange hatte es eine gleichberechtigte Bedeutung mit den vielen anderen Dingen, die ich hier aufbewahre. Doch heute Abend strahlt es eine besondere Stärke aus, einnehmender als je zuvor.
Alles andere ist nur um es herum.
Der Tag, an dem Anders geboren wurde, blieb einigen als ein besonderer Tag in Erinnerung. Ich war damals noch nicht einmal gedacht.
Für seine Mutter Sieke war es wie für alle, fast alle, gewordenen Mütter der glückliche Tag einer ersten Geburt, deren Schmerz nach wenigen Wochen einer eher verklärten Erinnerung gewichen war. In dieser Erinnerung tauchte nur am Rande ihre Jugendfreundin Agata auf, die einen ersten Besuch hatte machen wollen, von der Hebamme aber barsch abgewiesen worden war. Der Vater, Boye Deletre, empfand diesen Tag als, wie er nicht müde wurde zu sagen, „Stolzestag“. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass er Mutter und Sohn Stunden nach der Geburt weder besuchte, noch sich nach ihrem Zustand erkundigte.
Dies konnte möglicherweise einer moralischen Haltung der Männer dieser Zeit zugesprochen werden. Doch so war er nicht.
Seit Beginn der Wehen hatte er sich in seine Kleinschmiede zurückgezogen. Er hielt das Feuer heiß, hämmerte und feilte stur und stundenlang vor sich hin, bis er - nun eigentlich stolz - mit einer Leiter, einer Kelle, einem Eimer voll englischem Mörtel und der Quelle seines heroischen Stolzes, einer großen, eisernen Platte, auf die kleine Straße hinaustrat. Vor der Haustür stellte er die Leiter an der Wand auf, stieg hinauf und schlug, nichts anderes wahrnehmend, ein Loch in die Hauswand.
Dort hinein arbeitete er sehr, sehr sorgfältig das Eisenschild und verankerte es gut, damit mit ihm nicht dasselbe wie mit der Kanonenkugel in der Kirchenwand am frühen Morgen des gleichen Tages geschehen würde.
Nachdem Anders schon drei Stunden auf dieser Welt war, auf der er nichts als ohrenbetäubende Klopfgeräusche zu hören bekam, nachdem Sieke nach ihren Schmerzen eingeschlafen war und die Hebamme mit dem ungewöhnlichen Namen Wieglinde unaufhörlich auf den Rabenvater geschimpft hatte - und das zum Glück in einer absolut unverständlichen Mischung aus Dänisch und Friesisch -, nach all dem also stand der Vater im starken Regen auf dem glänzenden Kopfsteinpflaster vor seinem Haus und starrte klitschnass sein Schild an, auf dem stand:
„Jenes sei dessen Vaterland, in welchem nicht er arbeite, sondern in welchem er geboren sei.“
Die Schrift war wie die Platte aus Eisen. Beides war grau, so grau, dass man es im Regen mit sehr guten Augen erkennen, jedoch kaum lesen konnte. Doch für den Schöpfer war es der Mittelpunkt der Stadt. Und wie alle Schöpfer bildete er sich von nun an ein, dass jeder es ebenso empfinden müsse. Dabei gab es zunächst außer ihm nur einen, der auch so empfand - trotz der Undurchdringlichkeit des Textes, der unbeholfenen Grammatik und des nahezu Unergründlichen der offensichtlich hintergründigen Gedankenwelt des Schmiedemeisters.
Erst nach dieser Arbeit stiefelte Boye in das Schlafzimmer seiner Frau. Und er flog gleich wieder hinaus, wohl wegen seiner triefenden Nässe, so weit Wieglinde zu verstehen war. Erst mit trockener Kleidung gelang es ihm, wenige Minuten in dem Zimmer zu bleiben. Er sagte: „Alles gut?“ zu seiner Frau und rief viel zu laut zu seinem Sohn, während er ihm einen schwarzen Fingern auf die Nase drückte: „Mein Stummel!“ Daraufhin wurde er vor die Tür gesetzt.
Für Pastor Klaasen blieb dieser Regentag des Jahres 1820 vor allem in Erinnerung, weil er seinen nicht endenwollenden Dienst in der Stadt antreten sollte. Und weil er dieser Dienst nicht antreten konnte. Denn sein Vorgänger, der in den vernebelten Altersruhestand versetzte Pastor Ebsen, wollte nicht weichen. Er verstand aus seinem Nebel heraus nichts, war er doch im hohen Alter vieler falscher Meinungen wie unter anderen der, er wäre knabenhaft jung, oder zum Beispiel einer anderen, nach der er sich immer noch um die Seelen seiner Anbefohlenen kümmerte, statt dass seine Anbefohlenen sich eher ernsthafte Sorgen um seine Seele machten. Immerhin war er wiederholt halb nackt und laut singend vom Friedhof bei nahezu jeder Tageszeit weggeführt worden.
Für Pastor Klaasen blieb dieser Tag aber auch denkwürdig, weil er der Abschluss einer viertägigen Reise von Kopenhagen aus gewesen war. Es war eine Reise, die zwei Tage dauern sollte, die bis weit über die Stadt Schleswig gut verlief, dann aber in Sichtweite des Reiseziels ins Stocken geriet. Der Pferdewagen des Pastors war auf der verlehmten und eingewässerten Landstraße nahezu versunken. Niemand seiner zukünftigen Seelen hatte einen und einen halben Tag lang auch nur im Entferntesten daran gedacht, den neuen Pastor zu befreien. Schließlich erfuhr der ansässige Apotheker von dem Ungeschick und bestach mit Geld einige Landarbeiter und Fischer, um Klaasen ausgraben zu lassen.
Der untersetzte, korpulente Klaasen kam in der Stadt an wie ein Schwein, und seine Helfer hatten diesen Zustand zusätzlich verschlimmert. Dies prägte Klaasens Sicht auf die Mitglieder seiner neuen Gemeinde für die folgenden Jahrzehnte, nach denen er die Stadt in ähnlicher Weise wieder verlassen sollte. Hätte er es gewusst, dann wäre er gleich im Morast geblieben - viel lieber jedoch in der fernen Hauptstadt.
Der junge Apotheker Jasper Jaspersen, ein schlaksiger, haarloser, ernsthafter Frühwitwer, nahm Klaasen freundlich auf und ließ ihn zunächst bei sich wohnen, bis Ebsen nach Wochen gut gefesselt aus dem Pastorat getragen wurde.
Diese Umstände, aber auch das Wissen darüber, dass sich nun endlich zwei gebildete Menschen in dieser Stadt getroffen hatten, die auch zum Glück Junggesellen waren und zusätzlich den vom Apotheker mit hundertprozentigem Alkohol versetzten Fliederbeersaft sehr liebten, machten aus den beiden zunächst ein stets etwas brüchige Männerfreundschaft. Sie begann am Tage der Ankunft mit der Erörterung, inwiefern Boye Deletre das Recht zu der schon erwähnten Wandtafel mit der genannten Schrift haben könnte. Ebenfalls setzte man sich darüber auseinander, ob der Inhalt dieser Schrift bedeutete, Heimat sei nur dort, wo man geboren worden sei. Der Unterschied zwischen Heimat und Vaterland blieb dabei unberücksichtigt. Schließlich erhob sich die Frage, ob diese Schrift nicht ein Affront gegen all diejenigen wäre, die diese Stadt ebenfalls als Heimat begreifen, da sie dort leben und arbeiten würden, auch wenn erst das Schicksal sie hier hergeführt habe. Der Apotheker schien der einzige gewesen zu sein, der den Inhalt der Schrift verstanden hatte. Doch auch das blieb eigentlich immer unklar.
Obwohl die Aktion des Schmieds wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgegangen war, verblieb allgemein die Auffassung, dass Boye damit erstens die Geburt seines Sohnes würdigen wolle und er zweitens sowieso einen leichten Dachschaden habe, was schon seit seiner frühen Kindheit für niemanden ein Geheimnis gewesen war.
Zu der ersten Ansicht sollte sich Boye in seinem viel zu kurzen Leben nie äußern. Doch zu dem zweiten Einwand ließ er hören, ihm seien nur zwei mit einem Dachschaden in der Stadt bekannt, und das seien der alte Pastor Ebsen und der Gemeindeausrufer Lorenzen. Diese Aussage wurde allgemein verurteilt, nicht weil man sich über Ebsen nicht einig gewesen wäre, sondern weil Lorenzen indirekt ein Opfer Deletres geworden war. Denn Boye war es gewesen, der im Auftrag des alten Pastor Ebsen die alte Kanonenkugel aus der angeblich schwedischen Belagerung der Stadt an ihrem Einschlagort, der nördlichen Kirchenwand, eingemauert hatte. „Zur mahnenden Erinnerung“, hatte Ebsen betont. Dies hielten viele für unverständlich, denn zu den Schweden hatte niemand mehr so ein rechtes Verhältnis.
Zwar war allen der Kosakenwinter vor sieben Jahren, an dem die russische Armee, eigentlich eher gegen Napoleon und Kopenhagen, mehrere unverbesserliche Monate lang die Stadt und die Bürger malträtiert hatte, in bester Erinnerung. Doch war man sich über die tatsächliche Verbindung dieser Soldaten zu den Schweden nicht so recht im Klaren. Und auch die Schlacht von Sehestadt, wo auch immer das lag, war nur aus wirren und widersprüchlichen Erzählungen Ebsens bekannt.
Wenn man schon international dachte, dann eher gegen die Franzosen mit ihrem Napoleon. Sie waren zwar Bündnispartner der Dänen gewesen waren, hatten aber zu ihrem großen Nachteil mit den Spaniern den für fast jeden Anwohner gut florierenden Schmuggel mit den Engländern zu unterbinden versucht. Sie hatten damit - wie auch immer das gehen sollte - den gesamten Kontinent absperren wollen - ein ziemlich unsinniges Unterfangen.
Nach einigen grundsätzlichen Gesprächen in der Stadt bei jeder guten Gelegenheit einigte man sich gegen die Franzosen und in der Tendenz für die Engländer. Denn sogar als diese die Elbe blockiert hatten, damit kein französisches Schiff seine Ladung dorthin befördern konnte, hatten sie immer einen regen Schiffsverkehr mit dem kleinen Hafen der Heimatstadt aufrechterhalten.
Hier waren nun einmal grundeigene Bedürfnisse angesprochen, und die Schweden hatten für den Schmuggel nun wirklich nichts geleistet, was bekannt und erwähnenswert war.
Jaspersen hatte zu dieser speziellen Frage der Außenpolitik einen eigenen Standpunkt, für den sich aber nun tatsächlich niemand interessierte.
Dass sich der Gemeindeausrufer Lorenzen in seiner abgewetzten Uniformjacke nun gerade an dem Morgen des Stolzestages unter dieser Kugel an der Kirchenmauer herumdrücken musste und dass sich ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die rostige Kugel eigenwillig aus der Wand lösen musste, dafür machte Boye Deletre andere Kräfte verantwortlich.
„Und sonst“, ließ er einmal und dann nie wieder zu diesem Problem verlauten, „bin ich Kleinschmied und eigentlich Schlosser, aber überhaupt nicht Maurer.“
Damit war Pastor Ebsen nicht nur auch für diese Angelegenheit schuldig gesprochen worden. Er hatte zusätzlich in der Stadt einen Gleichgesinnten, den überaus debilen Gemeindeausrufer Lorenzen, der allerdings durch den gesamten Vorgang keinen Einschnitt in sein berufliches Leben erfuhr.
Der junge Apotheker Jaspersen aus dem dunklen Jütland hatte für die Leiden des Ausrufers einige Salben zur Auswahl, und der neue Pastor diente mit dem zweiten Buch Mose: Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich.
Ansonsten beschäftigten sie sich an diesem verregneten Stolzestag jedoch schon mehrere Stunden mit dem Inhalt der Schrifttafel und dem Wort Heimat. Während der genügsame Pastor den Schlosser ebenfalls für sans facon hielt, bestand Jaspersen aufgeregt darauf, dass der Ausspruch einer 1767 erschienenen Schrift Eiler Hagerups mit dem Titel Brev om Kierlighed til Faedrelandet entliehen sei, die er aus der von seinem Apothekervater ererbten Bibliothek herauszog.
Er wies dem zunehmend gelangweilten Gast nach, dass die Ähnlichkeit der Gedanken Hagerups mit denen des Handwerkers den subtilen Geist dessen aufdecken würde. Zusätzlich würde Deletre das Gedankengut schamlos verdrehen, indem er den Hintergrund dieser Gedanken, die sich einst gegen die übermäßige Einflussnahme deutscher Ausländer in Dänemark gerichtet hatten und somit als Gedanke dänisches Nationalgut seien, verfälschen würde.
Da aber der Schlossermeister so weit gegangen sei, dieses dänische Nationalgut gegen ihn, den Mann aus Skagen, zu wenden, würde er mit Tyge Rothe, dem Sohn deutscher Einwanderer und Deutschtümler kontern:
„Das Volk, worunter der Mensch lebt als Bürger, das ist sein Vaterland.“
Nach langer und stets durch Müdigkeit unterbrochener Überlegung konnte Pastor Klaasen mit diesem Satz leben, da er gerne, was er dem Apotheker lieber nicht anvertraute, Jasper Jaspersen und Boye Deletre auf die gleiche Ebene als Bürger und Besitzer einer gleichen Heimat stellen wollte.
Jaspersen ließ eine neue Eingangstür für die Apotheke anfertigen, in die der Satz von Tyge Rothe in dänischer Sprache eingeschnitzt wurde. Auch Jaspersen glaubte vergebens, dass dies den Kunden der einzigen Apotheke der Gegend unbedingt ins Auge stechen müsste, vergaß aber, dass nicht alle Dänisch sprachen oder gar lesen konnten.
Und ohnehin dachte niemand auch nur im Geringsten daran, dass diese Tür das Ergebnis eines heimlichen Geistesstreites zwischen dem Apotheker und dem Schlossermeister sein könnte. Am wenigsten aber schien Boye dies vermutet zu haben. Immerhin betrat er öfter die Apotheke, um Salben zu kaufen oder angefertigte Gestelle für die, wie er sagte, Apothekerhölle abzuliefern. Damit war Jaspersens Laboratorium gemeint, das er stets erweiterte, aber auch renovierte, weil es in ihm häufig brannte.
Es ist auch nicht bekannt, ob es Boye auffiel, dass Jaspersen ihn seit dem Stolzestag besonders häufig zu sich bestellte und bei diesen Besuchen abwartend lächelte. Allerdings mehrten sich die Arbeiten und Einkünfte der Kleinschmiede auffallend durch die nicht endenden Aufträge aus der Apotheke, und häufiger als früher wurde Boye in die Apotheke gerufen, um Zeichnungen, veränderte Zeichnungen für immer neue Stellagen, anzunehmen oder auch nur beratend tätig zu werden. Dabei wurde ihm niemals der Fliederbeersaft gereicht.
Doch immerhin wurde die Ladentür der Apotheke benutzt. An die Tür des Schlossers aber traute sich niemand mehr, nachdem das drohende Schild darüber hing, von dem man nicht wusste, ob es nicht auch eines Tages den Geist eines Menschen verwirren würde. Über viele Jahre verlor das Holz der Haustür die Farbe, und niemand strich die Tür, die, vielleicht weil sie für immer ruhen konnte, die Zeit und die Bewohner überlebte, während die Apothekertür eines Tages verbrennen sollte.
Das schmale Trottoir vor der Haustür des Schlossers blieb ebenfalls ungenutzt. Es veränderte sich in einem kleinen Halbkreis unter dem Eisenschild im Sommer zu einem blühenden Vorgarten, in dem Löwenzahn, Gänseblümchen, Hahnenklee und eine noch nie in der Gegend gesehene, schwarz blühende Pflanze stand, die Jahr für Jahr nach dem letzten Frost des Winters bis zum Frost des kommenden Winters unwiderstehlich ihre Pracht zeigte. Und als niemand mehr misstrauisch das schwere Eisenschild betrachtend vom Trottoir abwich, tat man es aus Respekt vor dieser Pflanze, die so lange erhalten blieb wie die alte Haustür und das Schild an der Wand.
Nur zwei Schritte habe ich mich fortbewegt von Anders Schießgerät. Mein Zurückdenken zog während dieser Schritte unaufhaltsam an mir vorbei. Es ist die Erinnerung an eine Zeit vor meinem Leben. Ich erinnere mich an das Erzählte und nicht an das Erlebte. Heute ist es vielleicht durch Besuche geweckt worden, den Besuch von Gustav und den seiner beiden Söhne einige Stunden später.
Wahrscheinlich sind diese schnellen Gedanken durch das, was Gustav mir gebracht hat, und das, was seine Söhne mir gesagt haben, ausgelöst worden. Würde man das Rätsel, wodurch Gedanken und deren Verlauf beeinflusst werden, lösen können, dann wäre die Macht über die Menschen grenzenlos.
Jetzt blicke ich auf das Schießgerät, und die Gedanken fliegen wieder zurück zu der Zeit um den Stolzestag.
In der Stadt standen in diesen Tagen ganz andere Themen im Mittelpunkt oft stundenlanger Plaudereien am Hafen, auf dem Marktplatz, beim Einkauf, an Gartenzäunen oder in den Wohn- und Schlafzimmern als das Thema Heimat.
Im Zusammenhang mit der über den Kanal von Kopenhagen gekommenen, auf dem Weg nach Altona, ebenfalls am Stolzestag, in der Flussmündung gesunkenen Dreimastbark CAROLINE MATHILDE entwickelten sich in kürzester Zeit Umstände, die sich - ohne Übertreibung - über Schleswig nach Kopenhagen und über Holstein bis weit hinter Hamburg herumsprachen.
Der Untergang der Bark war zunächst ein großes Rätsel, weil das Schiff als sicher galt. Es hatte noch unter englischer Flagge und dem Namen CAROLINE zurzeit der für diese Gegend recht vergeblichen Sperre des Kontinents die wildesten Manöver gefahren, wenn es von dänischen und französischen Schiffen verfolgt worden war. Der CAROLINE wurde wegen ihrer großen Erfolge viel nachgesagt. So sollte sie sogar mehrfach ungesehen den schmalen Kanal zur Ostsee passiert haben, ja, ernsthafte und angesehene Bewohner der Stadt schworen, als Zeugen mehrfach dem Schauspiel beigewohnt zu haben, bei dem die CAROLINE, verfolgt von einer beträchtlichen Anzahl verschiedener Kriegsschiffe, auf offenem Meer tatsächlich unsichtbar geworden war. Die auf diesem Schiff transportierten Schätze wurden mit jedem weiteren Jahr der Erzählungen reichhaltiger und wertvoller.
Dann gelang es den Dänen, die Bark eines Tages bei eindeutiger Sicht aufzubringen.
Sie wurde umgeflaggt und auf den Namen CAROLINE MATHILDE umbenannt. Das konnte einerseits als Versuch der Hauptstädter gewesen sein, sich als Erbe des ehemaligen Ruhms dieses Schiffes auszugeben. Andererseits aber wurde dies auch als späte Anerkennung für die im Exil lebende Königin Caroline Mathilde gewertet. Immerhin hatte Dänemark diese Dame lebenslang in die Stadt Celle verbannt, weil sie ein Verhältnis mit einem Altonaer, dem Berater des schwachsinnigen Königs, angefangen hatte, statt treu ihren Schwachsinnigen zu lieben.
Für die Bewohner der Stadt aber hieß das Schiff weiterhin CAROLINE.
Das eigentliche Interesse galt jedoch weniger dem Schiff als vielmehr der Ehefrau des Lotsen Pauls, Agata. Volquard Pauls war ein erfahrener Lotse, der sogar Navigation an der Lotsenschule unterrichtete und der während seines kurzen Ehelebens voll Gram an dem freiheitlichen Umgang seiner Frau litt. Agata, sonst eine sehr quirlige Frau, hatte scheinbar kurz nach der Hochzeit ein für die Stadt ungewöhnliches, offensichtlich unsittliches Leben geführt. Angeblich sollte sie, sobald ihr Mann ein Schiff bestieg, ihre Tür ganz unbekümmert jedem auf Reede liegenden Seemann geöffnet haben.
Mehrfach auf diesen Lebenswandel und den zunehmenden Verfall ihres Mannes angesprochen hatte sie Verwünschungen ausgestoßen, die - wie man behauptete - nach oft reiflicher Zeit auch tatsächlich eintrafen. Zur Erhaltung der Moral in der Stadt erhielt Agata somit den Zunamen „De Hex“ und ein Schicksal.
Das tat der Freundschaft zwischen Sieke Deletre und Agata Pauls keinen wesentlichen Abbruch, obwohl Boye diese Verbindung nicht gerne sah. Er verließ sogar das Haus, wenn Agata zu Besuch kam. Bei langen Frauengespräche, bei denen sich die beiden Freundinnen ständig und sehr laut ins Wort fielen, sodass es Boye ohnehin ein Rätsel war, wie sie sich verständigen konnten, klagte Agata ihr Leid über den sturen und gewalttätigen Ehemann, mit dem sie auch keine Kinder bekommen konnte. Die üblen Gerüchte über ihren angeblich unsittlichen Lebenswandel wies sie zurück und erklärte diese als rachsüchtig in die Welt gesetzte Verleumdungen des gehassten Mannes. Sieke glaubte ihrer Freundin.
An dem Morgen, an dem der Lotse Pauls die CAROLINE besteigen wollte, um sie sicher um die Sandbänke herum ins offene Meer zu manövrieren, war ein erneuter Streit unter den Eheleuten ausgebrochen. Dabei hätte Agata, wie die Nachbarn später bezeugten, dem Lotsen nachgerufen:
„Heute sinkst Du mit Deiner Bark. Dein nasser Tod, Volquard Pauls!“
Tatsächlich fuhr die Bark auf eine Sandbank und verschwand dicht vor der südwestlichen Küste mit allem und jedem so schnell im Mahlsand, dass bei Ebbe nicht einmal mehr die Mastspitzen zu sehen waren.
An diesem Tag hatte Agata - wie schon erwähnt - ihre Freundin am Kindbett besuchen wollen, um das Kind, das ihr in ihrer Ehe versagt blieb, zu sehen. Doch Wieglinde, die Hebamme, fürchtete den bösen Blick der Freundin. Agata wurde auch von Boye, der sich seinem Eisenschild hingab, keines Blickes gewürdigt.
Zu Hause lag Agata in Tränen über ihre Einsamkeit und Verzweiflung, als der örtliche Amtsdiener in Begleitung des Stockschließers erschien, um sie zu inhaftieren. Die Männer waren zwar irritiert über den Zustand der Lotsenfrau, führten dies aber später als Beweis für die Verdorbenheit der Frau an. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte sie noch nichts über das Missgeschick ihres Mannes erfahren haben. Sie wusste es aber vielleicht schon übersinnlich und spielte dem Kommando die Tränen und die Trauer nur vor, um einer möglichen Strafe zu entgehen. Diese Argumentation, so verquer sie auch war, schien sehr überzeugend zu sein, weil man sie gern so akzeptieren wollte.
Schließlich kam es zu einer Anklage gegen Agata Pauls, bei der ihr die moralische und ehrabschneidende Zerstörung des Geistes ihres Mannes zugeschrieben wurde. In Folge dessen war er daran gehindert worden, seinem für den Staat verantwortungsvollen Beruf erfolgreich nachzugehen. In Wirklichkeit aber standen hinter der Anklage die Furcht vor übersinnlichen Kräften Agatas und der Wunsch nach einer nun endlich zum Zuge kommenden Bestrafung unsittlicher Handlungen. Denn davor war jede andere ehrbare Frau zu retten.
Dieses nun allgemein anerkannte Problem war ein Grund für die Verzögerung der anstehenden Taufe im Haus Deletre. Der neue Pastor Klaasen war nach seiner kurzen und wenig überzeugenden Antrittspredigt ganz von seiner ihn erfassenden Aufgabe durchströmt, moralisch-sittlicher und religiöser Berater bei den Verhandlungen gegen Agata zu sein. Darüber hinaus konnte er seine Amtsgeschäfte nur bedingt verfolgen, solange der alte Pastor Ebsen das Pastorat belagerte, auf dem Friedhof sang oder tief schlafend und fast erfroren auf der Kanzel vorgefunden wurde.
Auch Sieke hatte das Interesse, die Taufe hinauszuzögern. Sie war verwirrt von den Umständen um Agata und wartete außerdem auf eine Nachricht ihres Zwillingsbruders Bendix, der nicht wie gewohnt vor Einbruch des Winters von der Grönlandfahrt heimgekehrt war. Ihr Vater, der Lehnsmann Pedersen, drängte zwar darauf, trotz der Ungewissheit über den Verbleib seines Sohnes Bendix den neuen Enkelsohn in den Kreis der Christen aufzunehmen. Doch zusammen genommen sprachen alle Umstände dagegen.
Dies änderte sich nach einigen Wochen mit der Hinrichtung Agatas im Februar des neuen Jahres.
Auf dem Hundsberg am Hafenausgang, ein Hügel am Deich nicht höher als eine gut gebaute Warft, der dennoch die höchste Erhebung des Ortes war und in allgemeiner Unkenntnis der Bergwelt eben Berg genannt wurde, auf dem die erlegten Seehunde oft im Jahr in Reih und Glied ausgelegt wurden, auf diesem Berg hatten Zimmerleute ein zweistöckiges Gestell errichtet. Am Fuße des Hügels hatten sich an diesem lurigen Tag nahezu fünfhundert Menschen versammelt.
Viele Bauern waren wegen der Unpassierbarkeit der morastigen Straßen mit Kähnen über die Bootsfahrten gekommen. Der Fährverkehr von Holstein aus war an diesem Tag vorsorglich verdoppelt worden. Außer den Seeleuten, die wegen der Windstille auf dem Fluss vor Anker lagen, waren auch sehr viele Bewohner der Stadt gekommen. Unter ihnen befand sich Boye, der neben seinem Schwiegervater einen Platz in der ersten Reihe erhalten hatte, da der alte Lehnsmann Pedersen besondere Privilegien in der Stadt genoss.
Nachdem der Scharfrichter mit seinen drei Gehilfen das obere Stockwerk des Blutgerüstes betreten hatte, erstiegen der Oberstaller, der Bürgermeister, Pastor Klaasen und die Ratsmänner der Stadt, unter ihnen auch der Apotheker Jaspersen, die untere Etage. Schließlich wurde Agata, die in ein weißes, bodenlanges Gewand gekleidet war, vor sie gestellt, während die Zuschauer so still wurden wie der Wind, der an diesem Tag fehlte. Als ein Ratsmann das nach Landesrecht gefällte Urteil verlesen hatte, wurde Agata, die im Gesicht so bleich war wie ihr Gewand, zu dem Scharfrichter hinaufgeführt.
Bevor sie sich aber ihren Kopf auf den Holzbock legen ließ, trat sie an die Kante des Blutgerüstes vor und sah enttäuscht, voller Hass und mit abfälligem Blick in die Menge. Dort erspähte sie Boye, der wegen seines langen, schwarzen, widerspenstigen Haars, des bartlosen Gesichts und der großen, dunklen, eingefallenen Augen leicht von allen anderen zu unterscheiden war. Ihm rief sie mit heller, klarer Stimme zu: „Mein Mann musste sterben, als dein erster Sohn geboren wurde, Boye Deletre. Und du wirst das Schiff nicht kriegen. Und dein Sohn auch nicht. Nichts werdet Ihr bekommen! Immer wieder nichts!“
Dann trat sie zurück, legte ohne weitere Hilfe ihren Kopf auf den Bock und ließ ihn sich abschlagen, wobei ein tiefes Ausatmen durch die bewegungslose Zuschauermenge ging. Die Honoratioren in der unteren Etage hatten zuvor ihren Platz verlassen, um von dem auslaufenden Blut nicht befleckt zu werden. Die Gehilfen des Scharfrichters legten den Körper mit dem roten Gewand und anschließend den Kopf sorgfältig in eine bereitgestellte Holzkiste, vernagelten sie und trugen sie an einen geheimen Ort außerhalb des Friedhofs, wo der Sarg vergraben werden sollte.
Boye hatte die Ansprache Agatas lächelnd zur Kenntnis genommen, verharrte jedoch mit diesem Gesicht, das ihn auch hinunter zum Fluss begleitete, wo er lange stand und weit in die dunstige Flussmündung starrte. Es war nahezu still. Die Flut drückte das braune Wasser in den Fluss, begleitet von unzähligen Eisschollen, die sich stauten, aneinander rieben und infolgedessen manchmal senkrecht wie die Mastspitzen eines Schiffes aus dem Wasser gedrückt wurden, um dann laut zerbrechend wieder hineinzufallen. Das waren die einzigen Geräusche, die zu hören waren, und es hätte nicht gewundert, wenn das Eis angefangen hätte zu sprechen.
Erst einen Monat später konnte die Taufe stattfinden, weil Pastor Klaasen für sich in Anspruch genommen hatte, ausführlich den moralisch-sittlichen und religiösen Zustand seiner Gemeinde zu überprüfen, bevor er einen Neuen in die Christengemeinde aufnehmen wollte. Erst der Besuch Pedersens bei Klaasen beendete diese Prüfung abrupt, wobei niemand in Erfahrung bringen konnte, wie sie verlaufen und zu welchem Ergebnis Klaasen gekommen war.
Für manchen Bürger verblieb ein fahler Nachgeschmack und eine stets wieder aufkeimende Verunsicherung, denn Klaasen hatte trotz mehrmaliger Nachfragen seine Untersuchungen immer nur mit einem Satz aus dem fünften Buch Mose kommentiert: „Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehern sein, und die Erde unter dir eisern.“
Sieke hatte sich nach dem Verlust und der stets zu hinterfragenden Glaubwürdigkeit ihrer toten Freundin langsam wieder gefangen, obwohl sie zu den wenigen gehörte, die an der Gerechtigkeit des Urteils zweifelten. Mittlerweile beschäftigte sie ein ganz neuer und tröstender Gedanke. Trotz der Sorge über den verschollenen Bruder wollte sie eine schnelle Taufe des ersten Sohnes.
Den Taufvorgang selbst hatte der unscheinbare Klaasen nicht beherrscht, und so war er auch nicht Mittelpunkt der anschließenden Feier der Schlosserfamilie, bei der außer Klaasen die Verwandtschaft Siekes anwesend war. Boyes Verwandtschaft war entweder verstorben oder einfach nicht zu erreichen gewesen. Da das Kind ohnehin nicht im Mittelpunkt stehen konnte, weil es ja auch an den komplizierten Gesprächen nicht teilnehmen konnte, wäre diese Rolle Sieke und Boye zugefallen.
Doch Sieke hatte sich um die nicht ablassenden Anfragen nach Eiergrog zu kümmern, und Boye schwebte auf einer anderen Ebene, weil seine Frau ihm zwischen zwei aufgeschlagenen Eiern nüchtern ihre erneute Schwangerschaft mitgeteilt hatte.
So musste Pedersen zum Zentrum des Geschehens heranrücken und eröffnete die Feier mit einem „Wohl-Sein“ auf das Enkelkind und auf seinen bei Grönland verschollenen Sohn Bendix sowie der von allen geteilten Gewissheit, sein Junge würde schon bald wiederkommen.
Pedersen, eher ein nüchterner, ernsthafter alter Herr mit einem wuchtigen Körper, einem kreisrunden, meist roten Gesicht, verschwindend kleinen, blauen Augen und einem haarlosen, rosaroten Schädel war ein perfekter Gastgeber.
Durch seine verschiedenen Ämter, unter anderem auch als Deichgraf, hatte er gelernt, sich und seine Sprache auf jeden einzustellen. Er verstand es, seine Partner geschickt zu tiefen und ernsthaften Gesprächen zu verführen. Nachdem er sich auf sein Altenteil gesetzt, den Hof seinem ältesten Sohn übergeben und den restlichen Kindern ein großes Geldgeschenk gemacht hatte, die Quelle auch der Schlosserei, hatte Pedersen sich seinen Vorlieben, der Verwaltungsarbeit, der Staatstheorie sowie der Literatur hingegeben. Zu einigen Persönlichkeiten des Gesamtstaates hatte er kraft seiner Interessen überraschend gute Kontakte aufgebaut.
Er stand im Briefwechsel mit dem noch jungen Uwe Jens Lornsen, der gerade von Holstein nach Kopenhagen wechselte, und hatte auch den Holsteiner Carsten Niebuhr kennengelernt und sich mit ihm über dessen Expedition nach Arabia felix auseinandergesetzt, die ein absolutes Debakel gewesen war, von der Niebuhr aber als einziger Überlebender wichtige Abschriften mitgebracht hatte. Über Themen dieser Art konnte Pedersen lange Gespräche zu führen, die er wegen seiner umfangreichen Bibliothek wahllos erweitern oder konzentrieren konnte.
Im Verlauf der Feier zog er Boye, der immer noch nicht zu wissen schien, dass er der Gastgeber des Festes war und - wie so häufig - ganz mit sich allein zu sein schien, auf den kleinen Hofplatz zwischen Wohnhaus und Schlosserei hinaus und eröffnete ihm überraschend: „Ich hab sie gekauft.“